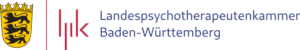BPtK-Fachtag Gender & Psychotherapie
(BPtK) Inwieweit sind soziales Geschlecht, Geschlechtsidentität und Geschlechterrollen in der Psychotherapie ein Thema? Beim Fachtag Gender & Psychotherapie der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) diskutierten Expert*innen und Psychotherapeutenschaft über eine geschlechtergerechte psychotherapeutische Versorgung. Dr. Dietrich Munz, BPtK-Präsident, unterstrich, dass die BPtK die fachliche Auseinandersetzung der Profession mit dem Thema Gender und Psychotherapie noch weiter intensivieren wolle. Geschlechtsbezogene Unterschiede in der Versorgung, aber auch in der Gesundheitsförderung und Prävention sowie der Forschung müssten zukünftig besser berücksichtigt werden. Gendergerechtere Entscheidungen könnten im Gesundheitswesen getroffen werden, wenn Frauen in die Entscheidungsfindung auch gleichberechtigt einbezogen würden. Dem schlossen sich Ulrich Bestle und Juliane Sim, Sprecher*innen der BPtK-Gleichstellungskommission, in ihrem Grußwort an. Ebenso müssten Ausgrenzungen sichtbar gemacht und benannt werden. Dies erfordere Engagement und müsse das Entwickeln von Lösungen zur Folge haben.
Geschlechtsspezifische Aspekte der psychotherapeutischen Versorgung
BPtK-Vizepräsidentin Dr. Andrea Benecke stellte die geschlechtsspezifischen Aspekte in der psychotherapeutischen Versorgung heraus. In der Psychotherapeutenschaft seien drei Viertel Psychotherapeutinnen. Mit Blick auf die Patient*innen zeige sich, dass Frauen häufiger und anders als Männer von psychischen Erkrankungen betroffen sind und sich öfter psychotherapeutische Hilfe suchen. Während im Kindesalter noch bei mehr Jungen als Mädchen eine psychische Störung diagnostiziert wird, kehrt sich dies ab dem Jugendalter um. Etwa jede dritte Frau, aber nur knapp jeder fünfte Mann ist von einer psychischen Erkrankung betroffen. Frauen erkranken etwa doppelt so häufig wie Männer an Angststörungen oder Depressionen. Auch Essstörungen sind unter Frauen wesentlich häufiger verbreitet. Männer sind dagegen deutlich häufiger suchtkrank. Zudem entfallen drei Viertel der Suizide auf Männer. Es sei wichtig zu verstehen, was die Ursachen dafür sind und wie ein anderer Umgang mit Sex (biologisches Geschlecht) und Gender (soziales Geschlecht) zu mehr Gleichberechtigung, psychischer Gesundheit und einer besseren Versorgung beitragen kann.
Die unterschiedlichen Erklärungsversuche dieser geschlechterbezogenen Unterschiede schließen sich jedoch nicht aus, sondern können sich auch ergänzen, erklärte Frau Benecke. Neurobiologisch gesehen, kann ein Ungleichgewicht der chemischen Botenstoffe im Gehirn eine psychische Erkrankung auslösen, zum Beispiel bei postnatalen Depressionen. Psychologische Erklärungsansätze betonen einen unterschiedlichen geschlechtsspezifischen Umgang mit Stress, wobei Frauen eher dazu neigen, ihre negativen Gefühle zu internalisieren, Männer dagegen eher externalisieren. Aus soziologischer Perspektive entspricht es der gesellschaftlich zugewiesenen Rolle der Frauen eher, dass sie ängstlich und depressiv sind und sich Hilfe suchen. Männer wiederum „kontrollieren“ ihre Emotionen – so der Stereotyp. Sie seien aggressiv, aktiv, abenteuerfreudig, unabhängig, durchsetzungsfähig und ehrgeizig. Sozioökonomisch betrachtet sind Frauen schlechter gestellt als Männer und schon dadurch mehr psychischen Belastungen ausgesetzt, die wiederum krank machen können.
All dies führt dazu, dass Frauen ungefähr doppelt so oft wie Männer psychotherapeutische Leistungen in Anspruch nehmen. In einer Befragung über Einstellungen zur Psychotherapie aus dem Jahr 2012 gaben fast drei Viertel der Frauen an, sich vorstellen zu können, bei Problemen selbst eine Psychotherapie zu absolvieren. Bei den Männern waren es weniger als 60 Prozent.
Doing Gender in der Psychotherapie
Professorin Dr. Brigitte Schigl, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften Krems, zeichnete nach, dass die Entwicklung der Psychotherapie und Frauenrechtsbewegungen korreliert: Während der Industrialisierung wurde die Rolle der bürgerlichen Frau als sorgende Hausfrau und Mutter, die sich selbst zurücknimmt, geprägt. Ihr wurde auch ihre Sexualität abgesprochen, was sich auch in der Freud’schen Theoriebildung widerspiegelte. In den 1960ern wurden Geschlechterrollen zunehmend kritisch hinterfragt. Dies geschah in einer Zeit, in der die Psychotherapie Eingang in die Versorgung fand und erste Ausbildungsmöglichkeiten in Europa entstanden.
Menschliches Handeln und Interagieren sei von Geschlechtszuweisungen überformt, erläuterte Schigl. Vorstellungen von Geschlecht und damit verbundene Normen prägten bereits, wie ein Kind erzogen und wie auf die unterschiedlichen Geschlechter reagiert werde. Was als typisch männlich oder weiblich gelte, seien Normvorstellungen, die von der gesellschaftlichen Sozialisation abhängen. Diese männlichen und weiblichen Stereotype seien Handlungsschablonen, auf die man zurückgreife, um sich zwischen den Geschlechterrollen zu verhalten. Genderstereotype herzustellen und zu reproduzieren sei ein aktiver Prozess. Eine zu starke Verwirklichung dieser Stereotype könne jedoch krank machen. Nicht immer sei das Kriterium Gender in sozialen Interaktionen vordergründig. Das soziale Geschlecht könne auch in den Hintergrund geraten, wenn andere Diversitätsvariablen dominierten und stereotype Verhaltensmuster anhand von Alter, Religion oder Herkunft geknüpft werden.
Das Konzept des „Doing Gender“, mit dem die Entstehung und Verfestigung des sozialen Geschlechts beschrieben werden kann, kann in der Psychotherapie ein wichtiger Ansatzpunkt sein, um psychisches Leiden anhand gesellschaftlicher Zuschreibungen erklären und gleichzeitig eine Vielfalt an Handlungsoptionen und eine größere Freiheit in Handlungsentscheidungen zu eröffnen. Doing Gender könne ein unterschiedliches Gesundheitsverhalten verursachen und erklären, und darüber Realitäten schaffen, in denen Männer und Frauen von bestimmten Krankheitsbildern unterschiedlich betroffen sind.
Doing-Gender spiele im gesamten Prozess der Psychotherapie eine Rolle. Das soziale Geschlecht beeinflusse beispielsweise, ob eine Patient*in in Eigeninitiative eine Psychotherapeut*in aufsuche oder ihre Präferenz für das Psychotherapeutengeschlecht. Bei der Diagnostik und Zielvereinbarung in der Psychotherapie oder auch bei gender-konnotierten Themen wie Sexualität, Paarbeziehungen oder auch Risikoverhalten spiele Gender eine Rolle. In der Beziehungsdynamik werde dies beispielsweise durch gefühltes Gleich- oder Anderssein, körperliche Signale und emotionale Involvierung zum Ausdruck gebracht.
Forschungsergebnisse zeigten, dass Männer und Frauen gleich gute Psychotherapeut*innen seien. Psychotherapeut*innen therapierten umso erfolgreicher und ihre Patient*innen seien umso zufriedener, je weniger konservativ die von ihnen vermittelte Einstellung zu Geschlechterrollen seien. Bei psychischen Erkrankungen, die eng an Gender-Stereotypisierungen gebunden sind, könne eine Psychotherapie einseitig gelebte Verhaltensweisen abmildern. Auch für die Resilienz sei es günstig, wenn eher gender-untypische Vorbilder des eigenen Geschlechts erlebt werden.
In der Psychotherapie müsse Gender als maßgebliche soziale Kategorie erfasst, das Wissen um genderspezifische Besonderheiten gestärkt sowie gendersensible und genderspezifische Versorgungsangebote entwickelt und implementiert werden.
Mutterschaft und Mütterlichkeit in der Psychotherapie
Mutterschaft und Mütterlichkeit würden bisher synonym verwendet. Es sei jedoch dringend notwendig, auch angesichts der fortschreitenden Reproduktionsmedizin, Mutterschaft auf die rein biologische Dimension zu beziehen und Mütterlichkeit als Beziehungs- und Fürsorgeverantwortung zu verstehen, erklärte Professorin Dr. Helga Krüger-Kirn, Universität Marburg. Würden Mutterrolle und Mutterliebe biologisch begründet, würden damit Erwartungen an Frauen gestellt, wie sie zum Wohle ihres Kindes zu handeln hätten. Bis heute werde ein heteronormatives Familienverständnis und eine naturgegebene Mütterlichkeit in Elternzeitschriften reproduziert. Die moderne Mutter stehe in einem Konflikt zwischen Mutterrolle und emanzipierter Frau, die in einem Idealbild der „Do-it-all-Mother“ münde. Dies spiegle sich auch in der psychotherapeutischen Praxis wider, da Mütter zunehmend unter den Vereinbarkeitsansprüchen zusammenbrächen. Die Schwangerschaft gelte als Zeit der psychischen Verletzlichkeit, fokussiere das Kindeswohl durch eine Vielzahl an Schwangerschaftsregeln, die zu einer Instrumentalisierung der Schwangeren führe. Dabei verdecke dies auch, unter welchen negativen sozialen und reproduktionsmedizinischen Bedingungen eine Schwangerschaft stattfinden könne, wie Armut, Gewalt oder fehlender Versorgung. Schwangerschaft könne außerdem als Phase der Zwischenleiblichkeit verstanden werden, in der zwei Körper in einem leben, aber dennoch getrennt und als Individuen zu verstehen seien. Hier könne die zugeschriebene Passivität der Schwangeren in eine kreative Form des Selbstausdrucks umgeschrieben werden. Das „Doing Mothering“ erlaube, Vorstellungen von Mütterlichkeit kritisch zu hinterfragen und zu mehr Geschlechtergerechtigkeit beizutragen. Mütterlichkeit brauche kein Geschlecht und folglich müssten daraus Konsequenzen für mehr elterliche Verteilungsgerechtigkeit gezogen werden – insbesondere in Zeiten, in denen tradierte patriarchale Familienmodelle wieder mehr Zustimmung gewinnen.
Frauenfeindliche Einstellungen männlicher Communities: Incels und Pick-up-Artists
Leichter und schneller als in der realen Welt finden sich in der digitalen Welt Männer, die sich von Frauen sexuell zurückgewiesen fühlen und deshalb gegen Frauen hetzen. Diese Involuntary celibates („unfreiwillig Zölibatäre“, Incels) seien Männer, die sich durch eine extreme, bösartige Ausdrucksform von heteronormativer Männlichkeit und der strukturellen Ablehnung des Weiblichen auszeichnen, erklärte Professor Dr. Rolf Pohl, Arbeitsgemeinschaft Politische Psychologie an der Leibniz Universität Hannover. Ihre Hauptantriebskraft bestehe aus dem Hass und der Abscheu gegenüber Frauen und speist sich aus dem, was Frauen Männern angeblich antun. Dies müssten die Frauen büßen, bis hin zu ihrer Ermordung. Dabei verstünden sich Incels selbst nicht als bösartig, in ihren Augen liegt das Böse in der Frau und dem feministischen Zeitgeist. Dieses paranoide Feindbild, die Vorstellung einer Feminisierung der Kultur und Schwächung des europäischen Mannes, zeige sich auch in der Ideologie und den Rollenbildern der neuen Rechten. Aus Sicht der Incels seien Frauen ein kollektives sexuelles Objekt. Das auf Frauen gerichtete sexuelle Begehren des Mannes mache den Mann abhängig von der Frau und mache ihn dadurch schwach, da er einem unausweichlichen Dilemma unterliege: dem männlichen Autonomieanspruch versus der Abhängigkeit von der Frau. Die Feindseligkeit der Incels gegenüber Frauen richte sich daher auch auf das Bestrafen der Frau für die erzeugte Abhängigkeit des Mannes. Incels seien aufgrund ihres Gewaltpotenzials eine reale Gefahr für Frauen.
Zu den frauenfeindlichen männlichen Communities gehörten auch die Pick-up-Artists, eine sektenähnliche Gemeinschaft, die sich als Verführungskünstler verstehen. Sie teilen Frauen in Kategorien entsprechend ihrer Attraktivität ein und reduzieren Frauen darauf, welche den Pick-up-Artists würdig, unwürdig oder unerreichbar seien. Aus Sicht der Pick-up-Artists manipulierten Frauen die Männer, um sie an sich zu binden und auszubeuten. Für Frauen sei das Verhalten der Pick-up-Artists irritierend und hoch verunsichernd. Pick-up-Artists träfen sich in Gruppen, um ihre manipulativen Techniken anzuwenden und sich gegenseitig in ihrem sexistischen Verhalten gegenüber Frauen zu bestätigen. Nicht selten münde das in einem Wettbewerb, wer die meisten Frauen mit den höchsten Punktwerten verführt.
Geschlechterungerechte Digitalisierung: Gender-Bias und Künstliche Intelligenz
Brigitte Strahwald, Koordinatorin der Pettenkofer School of Public Health an der Universität München, verdeutlichte, welche Bedeutung vollständige, unvollständige oder fehlende Daten für die genderungerechte Entwicklung von Künstlichen Intelligenzen in der Gesundheitsversorgung haben. Am Beispiel einer Roboter-Psychotherapeut*in in Form eines automatisierten Konversationsprogramms für das Internet (Chat-Bots) illustrierte sie, dass Sprachprogramme männliche und weibliche Zuschreibungen vornehmen. Diese könnten Stereotypen folgen, aber auch Annahmen von Gleichheit oder Unterschiedlichkeit treffen. KI-Algorithmen benötigten eine möglichst große Datenmenge, um daraus extrapolieren zu können und bei neuen Daten richtige Ergebnisse zu erzielen, indem sie kontinuierlich dazulernten. Wenn Daten jedoch nicht vollständig seien und Gender bei Diagnosen und Therapien nicht beachtet werde, könnten diese durch die KI nicht erkannt werden. So setzten sich Fehler fort und würden durch die Künstliche Intelligenz sogar „optimiert“ werden. Fehlende Studien mit Differenzierung nach Geschlecht, die Auswahl von Forschungsthemen und -fragen oder fehlende Genderspezifika in Klinik und Praxis trügen dazu bei, dass Algorithmen strukturelle Probleme reproduzierten. Von der Idee, dass künstliche Intelligenz objektiver sei, könne derzeit nicht ausgegangen werden; momentan habe sie eher ein nicht zu unterschätzendes Potenzial der Verzerrung. Zudem gebe es für non-binäre Personen gar keine Daten. Dabei habe Künstliche Intelligenz grundsätzlich das Potenzial, Gendergerechtigkeit zu schaffen und Fehldiagnosen und -behandlungen zu reduzieren. Die Initiative „sheHealth“ setze sich daher dafür ein, das Gesundheitswesen auf allen Ebenen gendergerechter zu machen. Für gute Algorithmen sei die Berücksichtigung des Doing-Gender essenziell, aber auch kulturelle, soziologische Aspekte müssten einbezogen werden. Auch Psychotherapeut*innen müssten mitgestalten, um gute Künstliche Intelligenzen zu entwickeln.
Psychotherapeutische Versorgung von Menschen mit Varianten der Geschlechtsentwicklung
Die deutsche Sprache sei sehr begrenzt, um geschlechtliches Erleben abzubilden, erklärte Dr. Katinka Schweizer, Professorin an der privaten Medical School Hamburg. Bei der Geburt sei das soziale Geschlecht nicht erkennbar, die Entwicklung der Geschlechtsidentität werde durch Einstellungen und Bewertungen der Gesellschaft stark beeinflusst. In den vergangenen Jahren sei die Gesellschaft schon ein Stück vorangekommen, in dem selbstbeschreibende Begriffe für Menschen mit Varianten der Geschlechtsentwicklung verwendet und abwertende Fremdbezeichnungen zunehmend abgelegt würden. Die Erarbeitung der Leitlinie zu Varianten der Geschlechtsentwicklung sei wegweisend gewesen, weil hier die Selbsthilfe- und Patientenorganisationen einbezogen worden seien. Eine Unterscheidung zwischen biologischem und sozialem Geschlecht sei notwendig und ermögliche es, zwischen Geschlechtsidentität, Geschlechtsrolle und sexueller Orientierung zu differenzieren.
Was ist die Geschlechtsrolle und wie die Geschlechtsidentität? Wenn diese Frage in der Psychotherapie gestellt werde, erlaube dies den Patient*innen sich hierzu zu äußern. Bei einer von 2.000 bis 4.000 Geburten komme ein Kind mit einer von über 50 bekannten Varianten der Geschlechtsentwicklung auf die Welt. Für die psychotherapeutische Versorgung dieser Patientengruppe sei es notwendig, dass das Wissen um diese Varianten der Geschlechtsentwicklung gestärkt werde und mehr Expert*innen zur Verfügung stünden. Die „optimal gender policy“ sei überholt, denn die Vorstellung von eindeutigen und stabilen Geschlechtsidentitäten sei nicht tragbar. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie und die Entwicklung eines zunehmenden Verständnisses von sich selbst seien daher zentral. Für die Versorgung von Menschen mit Varianten der Geschlechtsentwicklung sei es auch wichtig, dass sie psychosoziale Versorgung ab der ersten Diagnostik erhalten. Dies sei bisher jedoch noch nicht ausreichend sichergestellt, obwohl dies Unterstützung für Personen böte, ihre Geschlechtsidentität zu entwickeln, als auch bei der Frage, ob und welche medizinischen Eingriffe die Person für sich wünscht und vornehmen lassen möchte. Psychotherapeut*innen könnten insbesondere auch im Rahmen der Kommission, die über medizinisch notwendige Eingriffe bei Menschen mit Varianten der Geschlechtsentwicklung entscheide, aktiv dazu beitragen, dass operative Eingriffe kritisch hinterfragt werden.
Podiumsdiskussion: Wie kann der Gender Health Gap überwunden werden?
Dr. Christina Tophoven, BPtK-Geschäftsführerin, moderierte die Podiumsdiskussion, bei der Vertreter*innen der Bundespolitik sowie Krankenkassen und Verbände debattierten, worin der Gender Health Gap sich äußere und wie dieser überwunden werden kann.
Dr. Kirsten Kappert-Gonther, Grünen-Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Vorsitzende des Gesundheitsausschusses, kritisierte, dass in medizinischen Lehrbüchern grundsätzlich nur Männer abgebildet würden, mit Ausnahme der Reproduktionsmedizin. Deutlich werde der Gender Health Gap auch bei der Care- und Sorgearbeit, denn Frauen seien während der Corona-Pandemie häufiger und stärker belastet gewesen als Männer, was sich auch in einem Anstieg an Ängsten, Depressionen und Suiziden zeige. Genderstereotype engten Menschen ein, machten krank und müssten grundsätzlich überdacht werden. Eine verbindliche Quote in der Selbstverwaltung des Gesundheitswesens sei wichtig, denn es mache einen qualitativen Unterschied, ob alle Geschlechter in allen Gremien abgebildet seien oder nicht. Für ein gendergerechteres Gesundheitswesen seien paritätisch besetzte Entscheidungsgremien und gendersensible Gesundheitsforschung notwendig.
Für Kristine Lütke, FDP-Bundestagsabgeordnete, zeige sich der Gender Health Gap nicht nur in der Versorgung, sondern auch in der Planung und Verwaltung des Gesundheitswesens. Hier blicke man noch auf eine Blackbox, wo genderspezifische Herausforderungen bestehen. Sehr spürbar seien Geschlechterungerechtigkeiten mit Blick auf die Altenpflege, in der mehrheitlich Frauen arbeiten und diese psychisch stärker belastet seien. Die paritätische Besetzung von Gremien im Gesundheitswesen sei im Koalitionsvertrag vereinbart, aber man müsse auch darüber hinaus strukturelle Ungerechtigkeit abbauen, etwa beim Gender Pay Gap oder der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Karrierepositionen. Das gesellschaftliche Bewusstsein müsse für Missstände weiter geschärft werden, damit echte Gleichstellung erfolgen könne. Auch Gleichstellungschecks bei der Gesetzgebung befürwortete Lütke.
Gendergerechte Gesundheitsversorgung sei kein neues Thema, mahnte Ulrike Hauffe, stellvertretende Vorsitzende des BARMER-Verwaltungsrates. Es sei vielmehr eine Kontinuität, dass die Bedarfe und Bedürfnisse von Frauen missachtet und die Konsequenzen dieser Missachtung ignoriert würden. Quotierungen im Gesundheitswesen seien sinnvoll, denn es gebe Frauen, die diese Positionen besetzen könnten und auch wollten. Kritisch sei, dass in der Vergangenheit Wahlen vorgezogen worden seien, damit Männer ihren Machterhalt sichern konnten. Das freiwillige Aufgeben der Machtpositionen finde eindeutig nicht statt. Medizinische Leitlinien müssten gendersensibel erarbeitet werden und dazu müsse auch gendersensible Forschung stärker in den Fokus gerückt werden. Mehr Geschlechtergerechtigkeit könne nur durch konsequente Vorgaben erreicht werden, wie einer Quote. Die Geschlechterfrage müsse überall gestellt werden, vom Selbstverwaltungssystem bis zur Entwicklung von digitalen Gesundheitsanwendungen.
Dr. Christine Groß, Deutscher Ärztinnenbund, erläuterte, dass es männlichen Patienten häufig schwierig zu vermitteln sei, dass sie an einer Depression erkrankt seien, weil dies nicht in das Männlichkeitsbild passe. Aufklärung bedürfe es jedoch auch unter Mediziner*innen, dass die Symptome einer Depression sich bei Männern und Frauen unterschiedlich äußerten. Zwar seien die Vorstände der Ärztekammern deutlich weiblicher geworden, für die Kassenärztlichen Vereinigungen würden sich jedoch noch zu wenig Frauen bewerben, was auch an der Mehrfachbelastung von Frauen läge. Häufig würde bei Wahlen auch auf die Erfahrung geschaut, die jemand schon im Amt erworben habe, was Wiederwahlen begünstige. Am Beispiel des Marburger Bundes zeige sich, dass über eine Quotierung auch Frauen in Spitzenpositionen gewählt würden, die dann bei den nächsten Wahlen auch bestätigt werden könnten. Der Gender Pay Gap zeige sich in den medizinischen Fächern insbesondere in der Pädiatrie und Psychiatrie (wo der Frauenanteil besonders hoch ist), die schlechter vergütet werden als hoch technologisierte Fächer wie die Labormedizin (wo der Männeranteil besonders hoch ist). Die Approbationsordnung der Ärzteschaft müsse Genderaspekte endlich besser abbilden und auch verpflichtende Weiterbildungsangebote müssten vorgesehen werden. Die medizinischen Leitlinien müssen gendersensibel werden.
Mit der Erklärung, dass Männer nicht gut über Gefühle sprechen könnten und deshalb keine Psychotherapie beanspruchten, mache man es sich zu einfach, erklärte Dr. Andrea Benecke, BPtK-Vizepräsidentin. Geschlechtsspezifische Normen und Rollenbilder seien immer noch mächtig und fehlende Gendersensibilität führe über unterschiedliche Wege dazu, dass Patient*innen unterversorgt blieben oder fehl- wie auch überversorgt würden. Mit einem geschlechtersensiblen Blick böten sich Chancen, das Gesundheitssystem gerechter zu gestalten und dafür müssten Frauen einbezogen werden. In der neu verabschiedeten Musterweiterbildungsordnung seien geschlechts- und kultursensible Aspekte als verbindliche Inhalte niedergelegt. Eine gendersensible Psychotherapie müsse zukünftig der Versorgungsstandard sein. Mit Blick auf die Veränderung von Institutionen verwies sie auf die Erfahrungen der BPtK, wo es inzwischen kein Problem sei, Quoten zu erfüllen, da immer mehr junge Frauen für Ämter kandidierten. Viele Landespsychotherapeutenkammern hätten in ihren Satzungen eine paritätische Besetzung ihrer Organe festgelegt, was sehr zu begrüßen sei. In der Forschung sei es wichtig, dass die Perspektive von Frauen kontinuierlich stärkere Berücksichtigung erfahre. Analoge Erfolge der Gleichstellung müssten sich auch in der Digitalisierung des Gesundheitswesens widerspiegeln und dürften durch fehlende Daten und sich dadurch perpetuierende Fehler nicht wieder eingerissen werden.