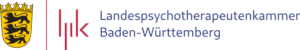BPtK-Veranstaltung zur psychotherapeutischen Versorgungsqualität in Psychiatrie und Psychosomatik
(BPtK) Mit der Einführung eines pauschalierenden Entgeltsystems für Psychiatrie und Psychosomatik (PEPP) und dem damit verbundenen Auslaufen der Psychiatrie-Personalverordnung (Psych-PV) wurde der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) vom Gesetzgeber beauftragt, Empfehlungen für die Ausstattung der Einrichtungen mit dem für die Behandlung erforderlichen therapeutischen Personal zu erarbeiten. Die Versorgungsqualität in Psychiatrie und Psychosomatik hängt – mehr noch als in der Somatik – entscheidend von der Anzahl und Qualifikation des therapeutischen Personals ab. Der gesetzliche Auftrag lässt jedoch Interpretationsspielraum hinsichtlich der Verbindlichkeit der Anforderungen an die Personalausstattung. Er lässt offen, ob es sich lediglich um Empfehlungen oder um verbindliche Mindestanforderungen für die Krankenhäuser handeln soll. Der G-BA hat bereits eine Arbeitsgruppe Personalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik (AG PPP) eingesetzt, die u. a. diese Frage diskutieren soll.
Empfehlungen oder Mindestanforderungen
Die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) veranstaltete am 10. März 2015 eine Tagung, um diese Frage mit Vertretern von Leistungserbringern, Kostenträgern und Patienten zu diskutieren. Als Vertreterin der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) sprach sich Dr. Sabine Haverkamp dann für verbindliche Mindestanforderungen aus, wenn gleichzeitig deren Finanzierung gesichert werde. Verbindliche Vorgaben zögen auch immer eine Prüfung dieser Vorgaben nach sich, die Vorgaben müssten deshalb ausreichend flexibel sein, damit sie von den Krankenhäusern auch erfüllt werden könnten.
Aus Sicht der Krankenkassen müsse vor allem gesichert sein, dass das Geld, was den Krankenhäusern zur Verfügung gestellt werde, auch in Personal umgesetzt werde. Quersubventionierungen anderer Krankenhausbereiche, wie sie unter der Psych-PV möglich gewesen wären, müssten zukünftig verhindert werden. Derzeit diskutiere der GKV-Spitzenverband vor allem, ob Mindestanforderungen für die gesamte Psychiatrie sinnvoll seien oder ob es nicht vielmehr darum gehe, in besonders qualitätssensiblen Bereichen, wie der Kinder- und Jugendpsychiatrie oder der Akutpsychiatrie, verbindliche Vorgaben zu machen, erläuterte Dr. Ute Watermann vom GKV-Spitzenverband.
Aus BPtK-Sicht sind verbindliche Mindestanforderungen und deren ausreichende Finanzierung zwingende Voraussetzungen, um eine gute Versorgungsqualität in Psychiatrie und Psychosomatik zu erhalten und zu erreichen. Eine qualitativ hochwertige Versorgung psychisch kranker Menschen sei vor allem gesprächs- und beziehungsorientiert, stellte BPtK-Präsident Prof. Dr. Rainer Richter fest. Gerade bei der Implementierung psychotherapeutischer Behandlungskonzepte gebe es erheblichen Nachholbedarf, da sich die wissenschaftlichen Erkenntnisse seit der Verabschiedung der Psych-PV entscheidend weiterentwickelt hätten. Dies könne nur erreicht werden, wenn ausreichend Psychotherapeuten und psychotherapeutisch geschulte Teams in der stationären Versorgung zur Verfügung ständen. Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, die es zum Zeitpunkt der Entwicklung der Psych-PV noch nicht gab, müssten im zukünftigen Personalportfolio der Krankenhäuser ausdrücklich verankert werden.
Podiumsdiskussion
Dem Ziel einer stärker psychotherapeutisch orientierten Versorgung in der Psychiatrie stimmte Dr. Iris Hauth, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) ausdrücklich zu. Die Fehler der Psych-PV, die vor allem in der Akutpsychiatrie kaum Psychotherapie vorgesehen habe, dürften nicht tradiert werden. Die Entwicklung der Anforderungen an die Personalausstattung sollte soweit möglich evidenzbasiert erfolgen.
Psychotherapie umfasse mehr als das psychotherapeutische Einzel- und Gruppengespräch, ergänzte BPtK-Präsident Richter. Eine psychotherapeutische Grundhaltung des gesamten Teams und psychotherapeutische Kurzinterventionen seien im stationären Bereich auch von immenser Wichtigkeit. Prof. Richter erinnerte an den Begriff der „Therapeutischen Gemeinschaft“. Dieser Ansatz sei lange aus der Mode gewesen, obwohl die positiven Auswirkungen auf die Gesundung der Patienten hinreichend bekannt seien. Heute entständen jedoch wieder Soteria-Stationen, die nach dem Prinzip einer therapeutischen Wohngemeinschaft arbeiten, wie z. B. am St. Hedwig-Krankenhaus in Berlin speziell für junge Patienten in psychotischen Krisen.
DGPPN-Präsidentin Hauth appellierte an alle Leistungserbringer, sich gemeinsam für eine ausreichende Finanzierung und Personalausstattung der stationären Versorgung psychisch kranker Menschen einzusetzen. Eine Forderung, die auch Prof. Dr. Michael Löhr, Experte im Bereich psychiatrische Pflege von der Fachhochschule Bielefeld, teilte. Die Erfahrungen mit der Einführung der Fallpauschalen (DRG) in den somatischen Häusern zeigten, dass es unter Kostendruck in einem pauschalierten Entgeltsystem vor allem zu massivem Stellenabbau in der Pflege gekommen sei. Diese Entwicklung dürfe sich in den psychiatrischen Häusern mit der Einführung des PEPP auf keinen Fall wiederholen. Dr. Claus Krüger vom Verband der Psychosomatischen Krankenhäuser und Krankenhausabteilungen in Deutschland (VPKD) sah deshalb vor allem auch die Notwendigkeit, eine funktionierende Qualitätssicherung in den psychiatrischen und psychosomatischen Einrichtungen einzuführen. Die Schaffung geeigneter Komplexcodes für die Leistungserfassung, in denen Prozess- und Strukturmerkmale kombiniert würden, könnten auch ein geeigneter Weg sein, Anforderungen an die Personalausstattung zu implementieren. Hierzu müssten jedoch die verschiedenen Leistungserbringer besser als bisher bei der Entwicklung des PEPP zusammenarbeiten.
Gleichzeitig dürfe das neue Entgeltsystem eine Weiterentwicklung der stationären Versorgung in Richtung eines flexibleren Behandlungsangebots, das in Abhängigkeit von den Patientenbedarfen und -bedürfnissen stationär, teilstationär, ambulant oder zu Hause erfolgen kann, nicht behindern. Auf diesen Punkt wies insbesondere Jurand Daszkowski vom Landesverband Psychiatrie Erfahrener Hamburg ausdrücklich hin.
Psychotherapeutische Versorgungsqualität – Beispiele aus der Praxis
Wie eine evidenzbasierte und psychotherapeutisch orientierte Versorgung in Psychiatrie und Psychosomatik unter den heutigen Bedingungen gelingt, war Thema des Nachmittags der BPtK-Veranstaltung. In einer Reihe von Fachvorträgen wurden Beispiele für eine gelungene Implementierung wirksamer, psychotherapeutischer Behandlungsansätze in den stationären Alltag vorgestellt.
Psychosen und Depressionen
Prof. Dr. Stefan Klingberg von der Universität Tübingen berichtete über ein stationäres Psychotherapie-Konzept für Patienten mit Psychosen. In manchen Krankenhäusern würde Psychotherapie bei der Behandlung von Psychosen immer noch als „Kunstfehler“ bezeichnet, zitierte er eine Klinik-Webseite. Das sei eine vollkommen überholte Auffassung von Psychosentherapie. In Tübingen sei es trotz der großen Heterogenität hinsichtlich des Krankheitsbildes, der sozialen Integration und der Komorbiditäten gelungen, ein 8-wöchiges Komplexprogramm zu etablieren, in dem alle erforderlichen Behandlungsansätze inclusive Psychotherapie integriert seien. Dabei würden die Patienten nicht selektiv aufgenommen, sondern in 80 bis 90 Prozent der Fälle von der Aufnahmestation überwiesen. Mit einer Personalausstattung von einem Arzt, 1,25 Psychologischen Psychotherapeuten, ½ Psychologen, einem Psychotherapeuten in Ausbildung und 8,5 Pflegekräften könnten 20 Behandlungsplätze (17 vollstationär und 3 teilstationär) entsprechend versorgt werden.
Unipolare Depressionen sind neben Psychosen ein Hauptaufnahmegrund in einem psychiatrischen Krankenhaus. Auch für unipolare Depressionen ist nachgewiesen, dass Psychotherapie eine wirksame Behandlungsmethode ist. Unter den derzeitigen Bedingungen können jedoch nicht alle Patienten ausreichend psychotherapeutisch versorgt werden, wie Dr. Sabine Hoffmann, leitende Psychologin der Abteilung Psychiatrie und Psychotherapie I&II in den Kliniken im Theodor-Wenzel-Werk in Berlin, berichtete. In ihrer Abteilung erhalten Patienten mit Depressionen kognitive Verhaltenstherapie, im Einzel und in störungsspezifischen Gruppen. Unter den derzeitigen Rahmenbedingungen erhielt nur knapp ein Viertel der Patienten Einzelgespräche in wünschenswertem Umfang und knapp ein Drittel eine störungsspezifische Gruppentherapie.
Besondere Anforderungen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie
Die Kinder- und Jugendpsychiatrie kämpfe insbesondere mit einer sinkenden Personalausstattung, stellte Jan Wiedemann, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Schleswig fest. Wiedemann mahnte, dass gerade Kinder- und Jugendliche eines besonderen Schutzes bedürften und ihre Rechte nicht selber einklagen könnten. Eine Personalausstattung, die aktuell nicht immer gewährleisten könne, dass die jungen Patienten leitliniengerecht versorgt werden könnten, sei nicht akzeptabel. Kinder Jugendliche müssen in kleinen Gruppen behandelt und betreut werden, große Stationen verstärkten den Stress für die Patienten und führten eher dazu, dass Symptome wir Unruhe, Hyperaktivität und Aggressivität sich verschlimmerten als verbessern. Gerade für die Kinder- und Jugendpsychiatrie scheinen verbindliche Vorgaben deshalb unerlässlich.
Komplexe störungsspezifische Therapieprogramme
Über die gelungene Integration einer störungsspezifischen Behandlung von Patienten mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) auf einer normalen Station, referierte Dr. Ernst Kern von der Psychiatrischen Klinik Sonnenberg in Saarbrücken. Auf seiner Station würden sechs Behandlungsplätze speziell für Patienten mit einer BPS angeboten, die dort mit einem störungsspezifischen Komplexprogramm (dialektisch behaviorale Therapie nach Linehan) behandelt würden. Die Ergebnisse zeigten, dass sich mit einem guten störungsspezifischen Therapiekonzept, ausreichend Personal und Zeit mit überschaubarem Aufwand ausgezeichnete Therapieerfolge erzielen lassen würden. Die meisten integrativen Konzepte dauerten 12 bis 13 Wochen und bezögen das gesamte Behandlungsteam ein, das weitergebildet sowie kontinuierlich geschult und supervidiert werde.
Über ähnliche Erfahrungen und Ergebnisse berichteten Prof. Dr. Jörn von Wietersheim bei der Behandlung von Essstörungen und Klaus Dilcher bei der Behandlung von Traumafolgestörungen. In der psychosomatischen Universitätsklinik Ulm werden magersüchtige Patienten mit einem intensiven und komplexen Behandlungsprogramm entsprechend den Leitlinienempfehlungen behandelt. In Urlauszeiten und bei Krankheit entstünden jedoch bei der aktuellen Personalausstattung Engpässe und Therapien müssten ausfallen, berichtete von Wietersheim. Auch im Pflegebereich reichten die vorgesehenen Stellen nicht aus, um Essbegleitungen und Nachbesprechungen, die heute zum Standard in der Behandlung von Essstörungen gehörten, ausreichend gewährleisten zu können. Auch gebe es derzeit noch zu wenige Zentren oder Ambulanzen, die auf die Behandlung von Essstörungen spezialisiert seien. Bei dieser komplexen, häufig chronisch verlaufenden und mit einem hohen Mortalitätsrisiko behafteten Erkrankung sei dies jedoch unbedingt erforderlich.
Auch die Behandlung von komplexen Traumastörungen erfordere eine ausreichende Personalausstattung mit spezifisch fortgebildeten Psychotherapeuten, erläuterte Dilcher, Leitender Psychologe und Geschäftsführer der Klinik am Waldschlösschen in Dresden. In seiner Klinik würden die Patienten in einem geschützten Rahmen vor allem intensiv einzeltherapeutisch behandelt, mit guten Therapieerfolgen. Die Kosten für die hierfür notwendige Personalausstattung seien im derzeitigen Krankenhausfinanzierungssystem nicht ausreichend abgebildet.
Unabhängig von Störungsbild und Krankenhaus plädierten alle Referenten einstimmig für ein besser ausgebautes psychotherapeutisches Angebot in den Krankenhäusern und eine Personalausstattung, die auch intensive Einzeltherapien mit den Patienten ermöglichten, da alle Erfahrungen zeigten, dass diese besonders wirkungsvoll seien.
(Statements und Fachvorträge der BPtK-Veranstaltung werden in einem Buch veröffentlicht.)