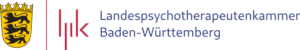BPtK fordert, den G-BA-Beschluss zur Bedarfsplanung zu beanstanden
(BPtK) Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat am 16. Mai 2019 die Bedarfsplanungs-Richtlinie geändert. Er hat damit den gesetzlichen Auftrag zur Anpassung und Verbesserung der psychotherapeutischen Versorgung, der ihm 2015 erteilt wurde, nicht ausreichend umgesetzt. Zum einen unterschätzt die Richtlinie massiv den wissenschaftlich und fachlich festgestellten Bedarf. Zum anderen hat der G-BA statt eines tatsächlichen Morbiditätsfaktors lediglich einen zusätzlichen Demografiefaktor eingeführt. „Im Ergebnis hat der G-BA eine Reform der Bedarfsplanung beschlossen, die willkürlich unter der Zahl der erforderlichen psychotherapeutischen Praxissitze bleibt, und mit dem Demografiefaktor einen Automatismus geschaffen, der künftig kontinuierlich zu einer schlechteren Versorgung psychisch kranker Menschen führt“, erklärt Dr. Dietrich Munz, Präsident der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK).
Die für die Psychotherapie besonders nachteilige Einführung des neuen Demografiefaktors erfolgte außerdem erst nach dem Stellungnahmeverfahren im G-BA. Die BPtK sieht darin einen formalen Fehler, der allein schon zur Beanstandung der beschlossenen Bedarfsplanungs-Richtlinie durch das Bundesgesundheitsministerium führen muss.
Ein vom G-BA in Auftrag gegebenes Gutachten hatte festgestellt, dass rund 2.400 zusätzliche psychotherapeutische Praxissitze notwendig sind, um eine bedarfsgerechte Versorgung psychisch kranker Menschen zu ermöglichen. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hatte gemeinsam mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft, den Patientenvertretern und den Ländern ca. 1.900 zusätzliche Psychotherapeutensitze insbesondere in ländlichen Regionen für erforderlich gehalten. Dieser wissenschaftlich und fachlich unstrittige Bedarf wurde jedoch vom GKV-Spitzenverband ignoriert. Er war mit einer politisch-strategischen Positionierung in die G-BA-Gespräche gegangen, generell keine zusätzlichen Praxissitze zu planen. Durch diesen Boykott einer fachlichen Auseinandersetzung war der G-BA nicht mehr in der Lage, eine sachgerechte Reform der Bedarfsplanung zu beschließen und seinen gesetzlichen Auftrag zu erfüllen.
Die Veröffentlichung des Beschlusses zeigt, dass der G-BA, anders als noch im Stellungnahmeverfahren vorgesehen, die Berechnung für die geplanten Praxissitze willkürlich und ohne eine nachvollziehbare fachlich-konzeptionelle Begründung geändert hat. Dadurch sank die Zahl der zusätzlichen psychotherapeutischen Praxissitze auf unter 800. Das ist weniger als ein Drittel des im wissenschaftlichen Gutachten festgestellten Bedarfs.
Hinzu kommt, dass der G-BA beschlossen hat, die Veränderung des Versorgungsbedarfs über einen Demografiefaktor, statt einen Morbiditätsfaktor zu erfassen. Damit lassen sich die Praxissitze aber nur an der sich verändernden Geschlechts- und Altersstruktur der Bevölkerung ausrichten und gerade nicht am wachsenden psychotherapeutischen Versorgungsbedarf. Schon hierbei wären Besonderheiten von psychischen Erkrankungen zu berücksichtigen gewesen. Psychische Erkrankungen treten, anders als die meisten körperlichen Erkrankungen, erstmals deutlich früher, in jüngeren Lebensjahren, auf. Auch die Häufigkeit psychischer Erkrankungen ist im Gegensatz zu körperlichen Erkrankungen bei älteren Menschen geringer. Insbesondere die über 75-Jährigen nehmen seltener psychotherapeutische Versorgung in Anspruch.
Der neue Demografiefaktor ist aber insbesondere nicht geeignet, eine veränderte Morbidität und einen wachsenden Bedarf an Psychotherapie zu erfassen. Er berücksichtigt ausschließlich die Veränderung der Altersstruktur der Bevölkerung und den über- oder unterdurchschnittlichen Leistungsbedarf der einzelnen Bevölkerungsgruppen. Er rechnet nicht ein, dass sich der Bedarf an psychotherapeutischer Versorgung in den vergangenen 20 Jahren nahezu verdoppelt hat. Aufgrund der Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen nutzen immer mehr Patienten professionelle Hilfe und Psychotherapie. Psychotherapie ist für fast alle psychischen Erkrankungen, allein oder in Kombination mit Pharmakotherapie, die leitliniengerechte Behandlung.
„Damit hat der G-BA die Bedarfsplanung gegen Veränderungen der Morbidität und des Behandlungsbedarfs immunisiert“, kritisiert BPtK-Präsident Munz. „Der fachlich falsche neue Demografiefaktor führt dazu, dass Jahr für Jahr die Zahl der psychotherapeutischen Praxissitze sinkt.“ Bereits in diesem Jahr sinkt dadurch die Zahl der rund 1.000 zusätzlichen Praxissitze auf 776 Sitze.