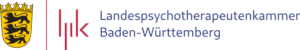BPtK befürchtet anhaltende Unterversorgung in psychiatrischen Kliniken
G-BA setzt Sanktionen bei Unterschreiten der Mindestpersonalvorgaben aus
(BPtK) Psychiatrische und psychosomatische Einrichtungen haben bis 2026 Aufschub bekommen, sich auf die die Personalvorgaben der Richtlinie „Personalausstattung in Psychiatrie und Psychosomatik“ (PPP-Richtlinie) einzustellen. Bis dahin müssen sie keine Konsequenzen befürchten, wenn sie diese unterschreiten. Das hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) in seiner gestrigen Sitzung beschlossen.
»Die gewonnene Zeit darf nicht ungenutzt verstreichen. Im Interesse der Patient*innen muss der dringend nötige Personalaufbau für eine leitliniengerechte Versorgung jetzt erfolgen“, mahnt Dr. Andrea Benecke, Präsidentin der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK). „Seit Jahren verschiebt der G-BA die Umsetzung des gesetzlichen Auftrags, eine leitliniengerechte psychotherapeutische Versorgung der Patient*innen im Krankenhaus sicherzustellen und die Personalmindestanforderungen entsprechend zu erhöhen.“ Statt eines kompletten Aussetzens der Sanktionen hatte sich die BPtK deshalb für eine Absenkung der Höhe der Sanktionen ausgesprochen, damit der befürchtete „Kahlschlag“ in der Versorgung abgewendet werden kann. Zugleich sollte der Anreiz für die Kliniken erhalten bleiben, das erforderliche Personal anzustellen und mehr vollstationäre Betten in stationsäquivalente, personaleffizientere tagesklinische und ambulante Behandlungsangebote umzuwandeln.
Gerade die Erfahrungen mit der Psychiatrie-Personalverordnung (Psych-PV) haben gezeigt, dass ohne einen gewissen Anpassungsdruck die erforderlichen Veränderungen häufig nicht erreicht werden können. „Wir hoffen, dass mit dieser G-BA-Entscheidung nicht eine weitere Abwärtsspirale beim therapeutischen Personal in den Krankenhäusern angestoßen wird”, sagt BPtK-Präsidentin Benecke. „Die Überlastung der vorhandenen Mitarbeiter*innen in den Häusern setzt sich nun erst einmal weiter fort mit der Gefahr, dass noch mehr Personal abwandert und sich die Überlastungssituation weiter verschärft.“
Aktuell erfüllt gerade mal die Hälfte der Einrichtungen einen Umsetzungsgrad von 90 Prozent, knapp 8 Prozent der Erwachsenenpsychiatrien erreichen nicht einmal einen Umsetzungsgrad von 80 Prozent der Personalvorgaben. Das geht aus dem 3. Quartalsbericht 2022 des Instituts für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG) zur Einhaltung der Mindestvorgaben hervor. Dies sind Zustände, die im Sinne der Patient*innenversorgung so schnell wie möglich geändert werden müssen.