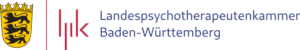Verbindliche Personalstandards für Psychiatrie und Psychosomatik
BMG legt Eckpunkte zur Weiterentwicklung des PEPP vor
(BPtK) Die Behandlung in psychiatrischen und psychosomatischen Krankenhäusern sowie Fachabteilungen soll sich zukünftig an Leitlinien orientieren. Die dafür notwendige Mindestausstattung an Personal soll verbindlich vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) vorgegeben werden. Das geht aus den Eckpunkten hervor, die das Bundesministerium für Gesundheit zur Weiterentwicklung des Psych-Entgeltsystems vorgelegt hat.
Damit ist eine wesentliche Forderung der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) erfüllt. „Die Behandlung von psychisch kranken Menschen erfordert vor allem personelle und zeitliche Ressourcen. Mit den jetzt konsentierten Eckpunkten besteht die Chance, die Personalausstattung in Psychiatrie und Psychosomatik zu verbessern“, stellt BPtK-Präsident Dr. Dietrich Munz fest. „Dem Anreiz Personal zulasten der Behandlungsqualität abzubauen, wird damit endlich entgegengewirkt.“
Die Eckpunkte sehen vor, dass die Krankenhäuser wie bisher krankenhausindividuelle Budgets verhandeln können, allerdings nicht mehr auf der Basis ihres Personaltableaus, sondern auf der Basis ihrer Leistungen. Die Leistungen sollen dafür mittels des PEPP abgebildet werden, d. h. es werden bundeseinheitliche Bewertungsrelationen auf empirischer Grundlage errechnet. Perspektivisch erfolgt die Kalkulation der Leistungen insbesondere auf den Qualitätsvorgaben, die der G-BA festlegt, da nur solche Einrichtungen an der Kalkulation künftig teilnehmen sollen, die die Vorgaben des G-BA erfüllen. Ferner soll ein bundesweiter Krankenhausvergleich etabliert werden, der als Orientierung für die Budgetverhandlungen vor Ort genutzt werden soll. Die Konvergenz zu landeseinheitlichen Basisfallwerten entfällt. Die Krankenhäuser können außerdem vor Ort Zuschläge auf ihr Budget aushandeln, die regionale Bedingungen und hausindividuelle Besonderheiten (z. B. regionale Versorgungsverpflichtung) berücksichtigen.
Die Budgetverhandlungen setzten auf den bisherigen Budgets der Krankenhäuser auf. Damit gehören die Krankenhäuser zu den Gewinnern, die in der Vergangenheit hohe Budgets vereinbaren konnten. „Krankenhäuser mit bisher eher geringen Budgets werden auch weiterhin Schwierigkeiten haben, ausreichend Mittel zu verhandeln, die sie für eine leitlinienorientierte Versorgung der Patienten benötigen“, kritisiert BPtK-Präsident Munz. Die Eckpunkte bieten auch bei der sektorenübergreifenden Weiterentwicklung der Versorgung psychisch kranker Menschen keine ausreichenden Lösungen. Der ambulante Sektor ist weiterhin nicht ausreichend einbezogen. Die Einführung von Home-Treatment als psychiatrisch-psychotherapeutische Akutbehandlung im häuslichen Umfeld ist letztlich eine einseitige Öffnung der Krankenhäuser für die ambulante Versorgung. Hier besteht weiterhin Handlungsbedarf.
Die Eckpunkte sollen noch in diesem Jahr gesetzlich umgesetzt werden. Für alle Krankenhäuser soll der Umstieg ab 1. Januar 2017 auf das neue Entgeltsystem verpflichtend werden.