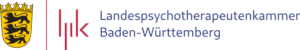BPtK-Forderung: Kein Ausschluss der Neuerkrankten von Telefonbehandlung
BPtK schreibt an Gesundheitsminister Jens Spahn
(BPtK) Die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) hat sich an Gesundheitsminister Jens Spahn gewandt, damit auch psychisch kranke Menschen, die neu erkrankt sind, telefonisch psychotherapeutisch beraten und behandelt werden können, wenn sie während der Coronakrise nicht anders versorgt werden können. „Der Ausschluss von Neuerkrankten von der psychotherapeutischen Telefonversorgung ist befremdlich“, stellt BPtK-Präsident Dr. Dietrich Munz fest. „In einem sozialen Gesundheitssystem muss jede Kranke* Anspruch auf professionelle Hilfe haben.“
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der GKV-Spitzenverband haben beschlossen, dass Psychotherapeut*innen rund eine psychotherapeutische Sitzung pro Monat (bis zu 20-mal 10 Minuten pro Patient*in pro Quartal) telefonisch beraten und behandeln können. „Für eine intensivere Behandlung stark belasteter Patient*innen reicht dies nicht aus“, kritisiert BPtK-Präsident Dr. Munz. „Unerklärlich ist jedoch, dass nicht auch Neuerkrankte, wenn es nicht anders möglich ist, telefonisch beraten und behandelt werden können. Unsere Kolleg*innen berichten, dass sie täglich neue Anfragen in ihren Praxen erhalten. Darunter sind insbesondere ältere Menschen oder solche mit somatischen Erkrankungen, die aufgrund der Ansteckungsgefahr nicht in die Praxen kommen können. Außerdem verfügen viele von ihnen nicht über die technischen Voraussetzungen, eine Videosprechstunde nutzen zu können oder leben in ländlichen Regionen mit unzureichender Internetanbindung.“ Der Ausschluss von der Telefonbehandlung trifft aber auch Kinder und Jugendliche, deren Familien sich finanziell die technische Ausrüstung nicht leisten können, um sich per Videogespräch von einer Psychotherapeut*in beraten und behandeln zu lassen.
„Sollte es keine andere Möglichkeit geben, ist der telefonische Kontakt während der Coronakrise unverzichtbar, um die psychotherapeutische Versorgung aufrechtzuerhalten“, erklärt BPtK-Präsident Munz. „Während der Coronakrise beobachten wir, dass sich depressive und Angstsymptome verstärken. Deshalb rufen uns täglich Patient*innen an, die Beratung und Behandlung benötigen, aber vorher noch nicht in unseren Praxen waren.
Unerklärlich ist für uns außerdem die Regelung, dass die Akutbehandlung nicht per Video erbracht werden kann. Gerade sie gäbe die Möglichkeit, mit bis zu 24-mal 25 Minuten Patient*innen in akuten Krisen rasch behandeln zu können. Eine patientenorientierte Lösung wäre es, während der Corona-Pandemie psychotherapeutische Leistungen generell auch per Telefon erbringen zu können.“