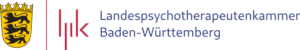Qualität von psychotherapeutischen Gutachten
Round-Table-Gespräch der BPtK
(BPtK) Am 13. April 2015 veranstaltete die Bundespsychotherapeutenkammer ein Round-Table-Gespräch zur Qualität von psychotherapeutischen Gutachten. Daran nahmen Experten aus der Arbeitsgemeinschaft Forensik und den Landespsychotherapeutenkammern teil. Hintergrund ist die Vereinbarung von CDU, CSU und SPD im Koalitionsvertrag, die Qualität von Gutachten insbesondere im familiengerichtlichen Bereich zu verbessern. Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) arbeitet derzeit an der Umsetzung dieses Ziels.
Regelungen der Landespsychotherapeutenkammern
BPtK-Vorstand Frau Andrea Mrazek berichtete eingangs, dass am 8. Juli 2014 ein Fachgespräch im BMJV stattgefunden habe. Die Politik wolle auch deshalb die Qualität von Gutachten insbesondere bei den Familiengerichten verbessern, weil in der Presse über spektakuläre Fälle von Sorgerechtsentscheidungen berichtet worden sei, die auf fachlich indiskutablen Gutachten beruhten. Auch eine Untersuchung der Fernuniversität Hagen sei zu dem Ergebnis gekommen, dass die Qualität von Gutachten im familiengerichtlichen Bereich nicht auf dem erforderlichen Standard gewährleistet sei. Am 19. November 2014 sei ferner eine einschlägige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (Aktenzeichen: 1 BvR 1178/14) ergangen.
Mrazek sah drei Problembereiche: Erstens gebe es verfahrensrechtlich keine Qualifikationsanforderungen an Gutachter, zweitens biete weder allein ein Psychologiestudium noch ein Medizinstudium die Gewähr für die gewünschte Qualität von Gutachten und drittens seien Sachverständigenlisten der Landespsychotherapeutenkammern erst im Aufbau und böten noch keine ausreichende Anzahl an qualifizierten Gutachtern. Die BPtK fordere deshalb gesetzliche Mindestanforderungen für die Qualifikation von Gutachtern festzulegen. Schließlich sei die Fortbildung einer ausreichenden Anzahl von Gutachtern erstrebenswert.
Elf von zwölf Landespsychotherapeutenkammern führten bereits Sachverständigenlisten und in zehn Landespsychotherapeutenkammern gebe es die Grundlage für Sachverständigenlisten bezogen auf das Familienrecht, berichtete Mrazek. Die Anzahl der eingetragenen Sachverständigen sei derzeit jedoch noch nicht ausreichend. Dies liege allerdings auch daran, dass die Fortbildungen noch nicht lange existierten. Es hätten bereits weit mehr Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten an den entsprechenden Fortbildungsveranstaltungen der Kammern teilgenommen als in die Listen eingetragen seien. Sie gehe daher davon aus, dass die Zahl der Sachverständigen in Zukunft erheblich steigen werde. Der Vorstand würde eine gesetzliche Regelung der Qualifikationen begrüßen und gehe davon aus, dass die Curricula der Psychotherapeutenkammern diese Anforderungen erfüllten.
Anforderungen an Gutachten aus fachlicher Sicht
Dr. Anne Liedtke, niedergelassene Psychotherapeutin in Halle mit langer Erfahrung in der Gutachtertätigkeit, stellte die strukturellen und inhaltlichen Anforderungen an Gutachten dar. Neben fachlichen Kenntnissen seien vor allem Kenntnisse der grundsätzlichen und aktuellen Rechtsprechung notwendig. Liedtke berichtete, dass Gutachten oft schon an der fehlenden Einhaltung des formellen Rahmens scheitern. Dazu gehöre insbesondere, die Fragestellung des Gerichts zu beachten. Aus ihrer Erfahrung falle es Gutachtern insbesondere zu Beginn ihrer Tätigkeit als Gutachter teilweise schwer, sich auf diese Fragestellung zu beschränken. Es werde häufig der Fehler gemacht, „alles“ zu untersuchen, obwohl das Gericht danach gar nicht frage. Das Gutachten müsse ferner vollständig sein und alle Angaben enthalten. Dazu gehöre insbesondere auch, wann mit wem gesprochen wurde. Auch psychodiagnostische Verfahren müssten mit Blick auf die Fragestellung ausgesucht werden.
Einen wesentlichen Teil des Gutachtenprozesses stelle neben der Aktenanalyse die Bildung relevanter Hypothesen nach wissenschaftlichen Grundsätzen dar. Zentral sei die Ableitung psychologischer Fragestellung aus der gerichtlichen Fragestellung. Im Gutachten müsse zwischen Untersuchungsberichten, testpsychologischen Untersuchungen und fremdanamnestischen Angaben klar unterschieden werden. Erst danach könne ein Befund erstellt werden, bei dem sie jedoch die Bezeichnung „familienpsychologische Erkenntnisse vor der Hintergrund der gerichtlichen Fragestellungen“ als Überschrift bevorzuge. Dann müsse die psychologische Fragestellung daraus abgeleitet und die gerichtliche Fragestellung beantwortet werden.
Eine häufige Fehlerquelle sei auch die Vermischung der Untersuchungsberichte und der Befunde, erläuterter Liedtke. Die Untersuchungsberichte müssten sich allein auf die Darstellung der Untersuchung beschränken und dürften nicht bereits eigene Schlussfolgerungen enthalten. Auch dürfte kein Auftrag übernommen werden, der gleichzeitig der Erstellung eines Gutachtens zur Glaubhaftigkeit und die familiengerichtliche Begutachtung enthalte. Dies müsse nach der Rechtsprechung voneinander getrennt werden. Die Qualität eines Gutachtens könne anhand der Kriterien Nachvollziehbarkeit, Transparenz, Überprüfbarkeit, Objektivität und Unparteilichkeit beurteilt werden.
Notwendige Qualifikation der Gutachter
Grundvoraussetzung für die Tätigkeit als Gutachter ist nach Liedtkes Auffassung ein abgeschlossenes Psychologiestudium, die Approbation als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut oder die Approbation als Psychologischer Psychotherapeut. Darüber hinaus sei eine spezifische Fortbildung erforderlich. Inhalt dieser Fortbildung sollte in jedem Fall ein Praxismodul sein, insbesondere Fallseminare, in denen ein Austausch von (potentiellen) Gutachtern mit Erfahrenen stattfinde, seien hilfreich.
Anforderungen an Gutachten aus juristischer Sicht
Joachim Lüblinghoff, Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Hamm betonte, dass aus seiner Sicht eine Gesetzesänderung notwendig sei, um die Qualität von Gutachten insbesondere im familiengerichtlichen Bereich zu verbessern. Dies sei zu Beginn der politischen Gespräche nicht durchgängig so gesehen worden. Ein Ansatz sei gewesen, die Koalitionsvereinbarung ausschließlich durch Gespräche mit relevanten Verbänden umzusetzen.
Fehler auch auf Seiten der Gerichte
Er gehe davon aus, dass im Jahr ungefähr 10.000 Gutachten in Deutschland in familiengerichtlichen Verfahren eingeholt würden. Er betonte, dass die Probleme nicht allein bei den Gutachtern liegen, sondern dass auch von Gerichten Fehler gemacht worden seien. Der Deutsche Richterbund e.V. habe dies auch betont. Insbesondere seien die Gutachten nicht ausreichend von Seiten des Gerichts begleitet worden. Seit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 19. November 2014 scheine nun eine Gesetzesänderung angestrebt zu werden. Sprachlich sei die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ungewöhnlich scharf formuliert, insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass es sich um eine Entscheidung einer Kammer und nicht eines Senats handle. Eine Formulierung wie „es sei schlechterdings nicht nachvollziehbar“ könne mit einem groben Behandlungsfehler im medizinischen Bereich verglichen werden.
Zwei Arten familiengerichtlicher Entscheidungen
Lüblinghoff unterschied zwei Verfahrensarten an Familiengerichten. Es gebe Verfahren, die auf Antrag eines Beteiligten eingeleitet werden, z. B. von den Eltern. Hauptstreitpunkt seien dann die elterliche Sorge und das Umgangsrecht. Diese Fälle – so bedeutsam sie für den jeweiligen Elternteil im Einzelnen seien – seien aus seiner Sicht die „Luxusfälle“ des Familiengerichts. Denn hier gehe es aus Sicht des Kindeswohls lediglich darum, bei wem das Kind „besser“ aufgehoben sei. Die Erziehungsfähigkeit beider Elternteile stehe in der Regel nicht zur Debatte.
Die zweite Gruppe seien die Verfahren, die von Amtswegen durchgeführt und auf Initiative von z. B. Jugendämtern oder auch Berufsgeheimnisträgern eingeleitet würden. Hier gehe es dann häufig um die Frage, ob ein Kind aus der Familie genommen werde. Er erläuterte den verfassungsrechtlichen Hintergrund dieser Arten familiengerichtlicher Entscheidungen.
Im Anschluss beschrieb Lüblinghoff die zuständigen Gerichte. Der Instanzenzug beginne beim Amtsgericht und dort bei der Abteilung Familiengericht. Als zweite Tatsacheninstanz sei dann unmittelbar das Oberlandesgericht zuständig. Als Rechtsmittel-instanz gebe es dann den 12. Senat des Bundesgerichtshofs. Über dem eigentlichen Instanzenzug sei das Bundesverfassungsgericht angesiedelt. Die Bedeutung der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts im familiengerichtlichen Bereich sei nicht zu unterschätzen. Ebenfalls befasse sich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte mit Fragen des Familienrechts.
Mindestanforderungen aus juristischer Sicht
Die juristischen Verbände arbeiteten derzeit an einem Papier, in dem die rechtlichen Mindeststandards an Gutachten beschrieben würden. Dieses Papier sollte in Form von Fragen zusammengefasst werden, die von den Gerichten zur Beurteilung dafür herangezogen werden könnten, ob ein Gutachten den aus rechtlicher Sicht bestehenden Mindeststandards genüge.
Stand der Gespräche mit den Verbänden
In der anschließenden Diskussion erläuterte BPtK-Vorstand Mrazek den Stand der Gespräche mit den Verbänden. Ziel des Round-Table-Gesprächs sei auch, die daraus gewonnenen Erkenntnisse in die weiteren Gespräche einfließen zu lassen. Die Teilnehmer diskutierten zunächst, wo entsprechende gesetzliche Mindeststandards verankert werden könnten. Eine Möglichkeit sei es, diese im Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) zu verorten. Eine weitere Möglichkeit seien allgemeine Anforderungen in der Zivilprozessordnung, z. B. in Bezug auf die Befangenheit von Gutachtern. Insgesamt bestand bei den Teilnehmern der Eindruck, dass es zielführender sei, sich hier auf den Bereich des Familienrechts zu beschränken und nicht zu versuchen, allgemeine Mindeststandards für Sachverständige festzulegen. Dies sei ein großes Rad und es stünde zu befürchten, dass das Ziel dann gar nicht erreicht werden könne.
Mrazek erläuterte, dass die BPtK bei familiengerichtlichen Gutachten keinen Approbationsvorbehalt in dem Sinne fordere, dass nur Approbierte Gutachten erstellen könnten. Es sei aber zu berücksichtigen, dass häufig psychische Erkrankungen zu beurteilen seien und dann entsprechend von nicht approbierten Gutachtern ein Psychotherapeut oder ein entsprechender Facharzt hinzugezogen werden müsse.
Notwendige klinische Erfahrung
Die Teilnehmer hielten aber unabhängig von der Frage der Approbation eine erhebliche klinische Erfahrung für notwendig. Liedtke führte aus, dass ohne entsprechende Erfahrung die Gefahr bestünde, psychische Erkrankungen zu übersehen und deshalb zu unzutreffenden Ergebnissen zu kommen. Insbesondere könne ein Gutachter ohne klinische Erfahrung z. B. eine Psychose nicht ohne Weiteres erkennen. Kontrovers wurde die Frage diskutiert, in welchem Umfang klinische Erfahrungen vorliegen müssten. Ein großer Teil der Teilnehmer war der Auffassung, dass das in der Psychotherapeutenausbildung ohnehin vorgesehene psychiatrische Jahr erforderlich sei und genau diese klinische Erfahrung vermittle. Ein Teilnehmer wies darauf hin, dass insbesondere bei jungen Kindern entwicklungspsychologische Grundkenntnisse zwingend vorhanden sein müssten. Wenn in einem Gutachten bei einem knapp dreijährigen Kind die Frage gestellt wurde, wie sich die Einschätzungen von Vater und Mutter unterscheiden würden, so deute dies auf fehlendes entwicklungspsychologisches Wissen hin. In diesem Alter könne ein Kind sich noch gar nicht in diese unterschiedlichen Positionen hineindenken. Dies mache ein ansonsten fachlich nicht zu beanstandendes Gutachten unbrauchbar.
Aus Nordrhein-Westfalen wurde berichtet, dass sich die Anforderung einer dreijährigen Tätigkeit im Maßregelvollzug bei Gutachten in diesem Bereich als sehr zielführend herausgestellt habe.
Begutachtung bei Rückführungsfällen
Bei der Frage der Qualifikation des konkreten Gutachters sei auch die Schwierigkeit des zu begutachtenden Falles zu berücksichtigen. Vor erheblichen Problemen stünden die Gutachter bei sogenannten Rückführungsfällen, also Fällen, in denen bereits eine rechtskräftige Entscheidung über das Sorgerecht gefällt worden sei und es nun um die Frage ginge, ob das Kind zu seinen Eltern oder zu einem Elternteil zurückkehren könne. Dann dürften keine Zweifel daran bestehen, dass das Kindeswohl nicht gefährdet sei. Hier sei es wichtig, dass Gutachter über entsprechende Erfahrungen verfügten und sich auch trauten, diese Zweifel auszuräumen. Für den Gutachter bestehe in den Fällen das Problem, dass es entsprechend auf ihn zurückfalle, wenn bei der Rückführung etwas „schief“ gehe.
Bei der Frage der Qualität von Gutachten sei auch zu berücksichtigen, dass ein solches Gutachten die betroffenen Familien erheblich belaste und nicht mehr aus der Welt geschafft werden könne. Daher sei es wichtig, keine vorschnellen oder qualitativ minderwertigen Gutachten zuzulassen. Ein weiterer wichtiger Aspekt sei es, dass die Gutachten fachgerecht erstellt würden. Gerade der zitierte Fall des Verfassungsgerichts zeige, was passieren könne, wenn das nicht der Fall sei.
Keine „Obergutachten“
Insgesamt waren sich die Teilnehmer einig, dass gesetzliche Mindestanforderungen notwendig seien. Die Teilnehmer diskutierten, inwiefern „Obergutachten“ dazu beitragen könnten, die Qualität von Gutachten unabhängig vom konkreten Gerichtsverfahren zu verbessern. Diskutiert wurde, ob es sinnvoll sein könne, dass die Kammern eine entsprechende Begutachtung vom Gutachten auf die Einhaltung von Mindeststandards durchführen könne. Die Teilnehmer kamen jedoch zu dem Schluss, dass dies mit den vorhandenen Ressourcen in den Landespsychotherapeutenkammern nicht möglich sei und eine Kontrolle insoweit nur im Rahmen der Berufsaufsicht durchgeführt werden könne. Die Teilnehmer diskutierten die insgesamt negative Presseberichterstattung über familiengerichtliche Gutachter. Dies sei auch der „Sensationsberichterstattung“ geschuldet. Hier wurde der Wunsch geäußert zu versuchen, durch die Vermittlung von Interviews o. ä. ein positiveres Bild der Gutachter in der Presse herzustellen.