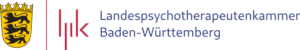Neues Disease-Management-Programm für Patienten mit chronischen Depressionen
G-BA schließt Psychotherapeuten als Koordinatoren der Behandlung aus
(BPtK) Patienten mit chronischen oder wiederkehrenden Depressionen können sich künftig im Rahmen eines strukturierten Behandlungsprogramms (Disease-Management-Programm – DMP) behandeln lassen. Die inhaltlichen Anforderungen für das neue DMP hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) in seiner Sitzung am 15. August 2019 beschlossen und hat damit einen gesetzlichen Auftrag aus dem Jahr 2015 umgesetzt. Das DMP richtet sich an Patienten mit chronischer Depression oder wiederholt auftretenden depressiven Episoden mit mittlerer bis schwerer Ausprägung.
Zentrale Bausteine des Behandlungsprogramms sind eine leitlinienorientierte Behandlung mit Psychotherapie und medikamentöser Therapie. Die konkreten Therapieempfehlungen richten sich insbesondere nach Verlauf und Schweregrad der Depression unter Berücksichtigung komorbider körperlicher und psychischer Erkrankungen. Auch das Vorgehen bei Suizidalität und Maßnahmen des Krisenmanagements werden im DMP adressiert. Jeder Patientin und jedem Patienten soll zudem – sofern sie aus ärztlicher oder psychotherapeutischer Sicht davon profitieren können – ein evaluiertes digitales Selbstmanagementprogramm unter qualifizierter Begleitung angeboten werden. Alternativ können auch evaluierte Präsenzschulungen angeboten werden.
Die Langzeitbetreuung und Koordination der Behandlung soll im DMP grundsätzlich durch den Hausarzt erfolgen. In Ausnahmefällen können dies auch spezialisierte Leistungserbringer wie beispielsweise Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie übernehmen. Dagegen können sich Patienten nicht bei ihrem Psychotherapeuten in das DMP einschreiben lassen. „Damit werden für Patienten, die bereits beim Psychotherapeuten in Behandlung sind, völlig unnötige Hürden für die Teilnahme am DMP aufgebaut“, bemängelt Dr. Dietrich Munz, Präsident der Bundespsychotherapeutenkammer. „Patienten sollten die Wahl haben, dass der Arzt oder Psychotherapeut die Koordination ihrer Versorgung übernehmen kann, der am besten mit ihrer Erkrankung vertraut und für sie der wichtigste Ansprechpartner ist. Der zentralen Rolle der Psychotherapie in der Versorgung depressiver Erkrankungen muss hier stärker Rechnung getragen werden.“
Sinnvoll erscheint dagegen, dass das DMP eine systematische Einbindung der Psychotherapeuten und Fachärzte im Behandlungsverlauf vorsieht. Eine Grundlage hierfür bilden die regelmäßigen Verlaufskontrollen, bei denen der koordinierende Arzt insbesondere die Symptomausprägung und -veränderung, das psychosoziale Funktionsniveau und Behandlungseffekte beurteilt. Wenn nach sechs Wochen hausärztlicher Behandlung noch keine ausreichende Besserung erzielt wurde, ist von ihm die Überweisung zum Psychotherapeuten oder entsprechend qualifizierten Facharzt zu prüfen. Eine stärkere Kooperation zwischen Hausärzten und Psychotherapeuten kann so zu einer leitlinienorientierten Behandlung beitragen.