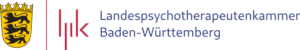Aktuelle Informationen
(BPtK) Aktuell treibt die Sorge um eine mögliche Ausbreitung des neuen Coronavirus (SARS-CoV-2) in Deutschland zahlreiche Menschen um. Bei dem Erreger handelt es sich um ein sogenanntes Beta-Corona-Virus, das mit den Auslösern von SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) und MERS (Middle East Respiratory Syndrome) verwandt ist. Die Symptome sind unspezifisch. Am ehesten treten Fieber und Husten auf, ebenfalls möglich sind Atemnot, Schnupfen, Halsschmerzen, Myalgien und allgemeines Krankheitsgefühl. Die Abgrenzung zu anderen respiratorischen Erkrankungen und Grippe ist dadurch nicht einfach. Eine Infektion sollte bei allen Personen vermutet werden, die aus betroffenen Regionen eingereist sind oder Kontakt zu Infizierten hatten.
Einschätzung des Robert Koch-Instituts
Zuständige Behörde für alle Fragen rund um COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2) ist das Robert Koch-Institut (RKI). Das RKI erstellt u. a. regelmäßig eine Risikobewertung für die Bevölkerung in Deutschland. Die massiven Anstrengungen auf allen Ebenen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes verfolgen bislang das Ziel, einzelne Infektionen in Deutschland so früh wie möglich zu erkennen und die weitere Ausbreitung des Virus dadurch so weit wie möglich zu verzögern.
Häufig gestellte Fragen
Das RKI informiert auf seiner Homepage über den aktuellen Stand und gibt Empfehlungen zum Verhalten und zur eigenen Vorsorge. Die regelmäßig aktualisierte Seite bietet auch eine umfangreiche Liste mit Antworten auf häufig gestellte Fragen zu COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2). Das RKI arbeitet eng mit verschiedenen Behörden und Einrichtungen zusammen – auf internationaler und nationaler Ebene – und erfasst kontinuierlich die aktuelle Lage, bewertet alle Informationen und veröffentlicht sie auf der Internetseite www.rki.de/covid-19. Auf der Website des Instituts findet sich zudem eine Risikobewertung des RKI für Deutschland.
Schutz vor Verbreitung von Coronaviren
Entsprechend der aktuellen Lage gibt das RKI Empfehlungen, welche Maßnahmen ergriffen werden sollen, um die Gesundheit zu schützen und das Auftreten von Erkrankungsfällen bzw. die Weiterverbreitung der Erkrankung zu verhindern. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) weist darauf hin, dass wie bei Influenza und anderen akuten Atemwegsinfektionen Husten- und Nies-Etikette, gute Händehygiene sowie Abstand zu Erkrankten (ca. 1 bis 2 Meter) auch vor einer Übertragung des neuen Coronavirus schützen. Diese Maßnahmen sind auch in Anbetracht er Grippewelle überall und jederzeit angeraten.
Informationen für die psychotherapeutische Praxis
Ambulant tätige Psychotherapeut*innen finden grundlegende Hinweise in Bezug auf ihr Tätigkeitsfeld in dem Leitfaden „Hygiene in der psychotherapeutischen Praxis“ [PDF-Dokument, 1,7 MB] vom Kompetenzzentrum (CoC) Hygiene und Medizinprodukte der Kassenärztlichen Vereinigungen und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung.
Für die Fachöffentlichkeit, zum Beispiel medizinisches Personal und Gesundheitsbehörden in den Ländern, stellt das RKI auf der COVID-19-Internetseite verschiedene Dokumente zur Verfügung.
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) bietet ebenfalls Informationen zum neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2, darunter auch Hygiene-Empfehlungen.
Melde- und Schweigepflicht in psychotherapeutischen Praxen
Die Meldepflicht richtet sich für Psychologische Psychotherapeut*innen sowie für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*innen nach den Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes sowie der neu geschaffenen Verordnung CoronaVMeldeV. Die maßgeblichen Bestimmungen lauten:
- 1 Absatz 1 CoronaVMeldeV:
(1) Die Pflicht zur namentlichen Meldung nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Infektionsschutzgesetzes wird auf den Verdacht einer Erkrankung, die Erkrankung sowie den Tod in Bezug auf eine Infektion ausgedehnt, die durch das erstmals im Dezember 2019 in Wuhan/Volksrepublik China aufgetretene neuartige Coronavirus („2019-nCoV“) hervorgerufen wird. Dem Gesundheitsamt ist in Abweichung von § 8 Absatz 3 Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes die Erkrankung in Bezug auf die in Satz 1 genannte Krankheit auch dann zu melden, wenn der Verdacht bereits gemeldet wurde. Dem Gesundheitsamt ist auch zu melden, wenn sich der Verdacht einer Infektion nach Satz 1 nicht bestätigt.
Des Weiteren:
- 8 Absatz 1 Nummer 5 Infektionsschutzgesetz:
(1) Zur Meldung sind verpflichtet:
[…]
5. im Falle des § 6 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1, 2 und 5 und Abs. 3 Angehörige eines anderen Heil- oder Pflegeberufs, der für die Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung oder Anerkennung erfordert,
und § 8 Absatz 2 Satz 2 Infektionsschutzgesetz:
Die Meldepflicht besteht für die in Absatz 1 Nr. 5 bis 7 bezeichneten Personen nur, wenn ein Arzt nicht hinzugezogen wurde. Konkret bedeutet das: Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sind zur Meldung nur verpflichtet, wenn 1. ein begründeter Verdacht nach den zwingend anzuwendenden Kriterien („Empfehlungen“) des RKI besteht und 2. kein Arzt hinzugezogen wurde.
Aus Sicht der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) besteht aufgrund der Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes für Psychotherapeut*innen keine Pflicht, Patient*innen aktiv auf den Verdacht einer COVID-19-Erkrankung hin zu befragen oder gar zu untersuchen. Dies bleibt Ärzt*innen überlassen. Gleichwohl ist denkbar, dass im Kontakt mit Patient*innen – sei es persönlich oder auch telefonisch – die Sprache auf Beschwerden gerichtet wird oder die Frage nach einer möglichen Erkrankung aufkommt.
Das Robert Koch-Institut als zuständige Behörde hat eine eigene Unterseite mit „Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zur Meldung von Verdachtsfällen von COVID-19“ eingerichtet. Dort heißt es:
„Empfehlung
Der Verdacht auf COVID-19 ist begründet, wenn bei Personen mindestens eine der beiden folgenden Konstellationen vorliegt:
1. Personen mit akuten respiratorischen Symptomen jeder Schwere oder unspezifischen Allgemeinsymptomen UND Kontakt mit einem bestätigten Fall von COVID-19
2. Personen mit akuten respiratorischen Symptomen jeder Schwere UND Aufenthalt in einem Risikogebiet.
Bei diesen Personen sollte eine diagnostische Abklärung erfolgen.“
Die Diagnostik einer „respiratorischen Symptomatik“ oder „unspezifischer Allgemeinsymptome“ wird von entsprechend qualifizierten Ärzt*innen geleistet; Psychotherapeut*innen dürften sich daher an den eher allgemein gehaltenen Fragen orientieren, die das RKI auf seiner Homepage veröffentlicht hat. Dort heißt z. B. es auf die Frage
„Welche Krankheitszeichen werden durch das neue Corona-Virus ausgelöst?“:
Eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus führt nach Information der Weltgesundheitsorganisation WHO zu Krankheitszeichen wie Fieber, trockenem Husten und Abgeschlagenheit. In China wurden bei einigen Erkrankten auch Atemprobleme, Halskratzen, Kopf- und Gliederschmerzen und Schüttelfrost berichtet. Bei einigen Erkrankten traten zudem Übelkeit, eine verstopfte Nase und Durchfall als Krankheitszeichen auf.“ (Quelle: www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html).
Sollten im Kontakt mit Patient*innen also z. B. einige der oben beschriebenen Symptome berichtet werden, zudem Kontakt mit einem bestätigten Fall von COVID-19 oder Aufenthalt in einem Risikogebiet berichtet werden, sollte die Person zu einer weiteren ärztlichen Abklärung ermuntert werden.
Ist diese bereits erfolgt, entsteht kein weiterer Handlungsbedarf. Sollte die ärztliche Abklärung nicht erfolgt sein oder diese abgelehnt werden, besteht aus Sicht der Kammer eine Meldepflicht anhand der dafür vorgesehenen Abläufe (siehe Homepage des RKI).
Falls eine Meldung an das zuständige Gesundheitsamt erfolgen muss, ist dies kein Bruch der Schweigepflicht: Da es sich hierbei um eine gesetzliche Verpflichtung handelt, steht die Schweigepflicht nicht entgegen. Der Patient*in ist dies gemäß § 8 Absatz 3 der (Muster-)Berufsordnung mitzuteilen („Ist die Schweigepflicht aufgrund einer gesetzlichen Vorschrift eingeschränkt, so ist die betroffene Person darüber zu unterrichten“).
Informationen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) stellt auf ihrer Homepage Informationen zur aktuellen Lage und Informationsmaterial für Praxen wie auch für Patient*innen zur Verfügung. Sie finden diese Informationen hier. Neben Hinweisen auf Meldepflichten, Infektionsschutz und Hygieneregelungen werden auch die aktuellen Bestimmungen zu Entschädigungsansprüchen (Praxisinfo: Coronavirus – Anspruch auf Entschädigung bei untersagter Tätigkeit oder Quarantäne, Hinweise und zuständige Behörden [PDF-Dokument, 380 KB, Stand: 04.03.2020]) zum Download angeboten.
Die obenstehenden Informationen basieren auf einem Web-Artikel der Psychotherapeutenkammer NRW. Die Bundespsychotherapeutenkammer dankt der Psychotherapeutenkammer NRW für die freundliche Genehmigung, diese Informationen verwenden zu dürfen.