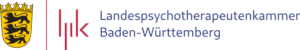Interview mit Dr. Dietrich Munz, Präsident der BPtK
(BPtK) Herr Munz, warum hat uns die Corona-Pandemie so herausgefordert?
Die Corona-Pandemie war für jeden Einzelnen zunächst einmal eine sehr ansteckende Erkrankung, im schlimmsten Fall mit tödlichem Verlauf. Sie hat aber auch die Gesundheitssysteme an ihre Grenzen geführt, weil sie für eine solche Ausnahmesituation nicht mehr ausgelegt sind. Ärzt*innen standen in nicht wenigen Ländern vor der Entscheidung, wen behandeln wir noch und wen lassen wir sterben. Die Normalität des medizinischen Alltags war dahin. Die Fragilität des einzelnen Lebens war wieder tagtäglich spürbar, aber auch die Verwundbarkeit unserer Zivilisation.
Was ist dadurch sichtbar geworden?
Etwas sehr Grundsätzliches: Dass wir auf außergewöhnliche Notlagen gesundheitspolitisch gar nicht mehr ausreichend vorbereitet sind. Alle Planungen gehen nur noch vom alltäglichen Durchschnitt aus. Die Grenzen dieser Logik des normal Nötigen bekamen wir durch die Corona-Pandemie deutlich aufgezeigt. Es wurde wieder klar, dass gerade Gesundheitsversorgung mit dem Außergewöhnlichen rechnen muss. Auch unser Gesundheitssystem unterliegt aber seit Langem einer kurzsichtigen Just-in-Time-Rationalität. Das Coronavirus hat uns wieder an sozialstaatliche Selbstverständlichkeiten erinnert: Unser Wohlfahrtsstaat ist nicht zu übertreffen, wenn das Schicksal zuschlägt. Das gilt nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für uns als Gesellschaft insgesamt. Gesundheitspolitik ist öffentliche Daseinsvorsorge. Sie ist ein öffentliches Gut, bei dem der Markt versagt. Zu diesen Gütern zählen neben Gesundheit Nahrung, Bildung, Wohnen, Umwelt und Kultur. Corona hat am Beispiel Gesundheit gezeigt, wie essenziell bei diesen Gütern staatliches Handeln und gesellschaftlich organisierte Vorsorge ist.
Sind Krisen und Katastrophen denn so außergewöhnlich?
Keineswegs, sie werden allerdings zu schnell wieder ausgeblendet. Dies ist der Blindheit politischer Standardprozesse geschuldet. Krisen und Katastrophen begleiten uns tatsächlich ständig. Die beiden Weltkriege des vergangenen Jahrhunderts liegen noch in der Lebenszeit heutiger Menschen. Ebenso die weltweite Wirtschaftskrise von 1929 und die Finanzkrise von 2008. Auch Tschernobyl 1986 und Fukushima im Jahr 2011 sind uns noch gut in Erinnerung. Naturkatastrophen, Dürren, Überschwemmungen, zerstörerische Stürme begleiten uns fast regelmäßig in den Nachrichten. Selbst an alarmierenden Vorläufern des Coronavirus hat es nicht gefehlt. Es gab die beiden Grippewellen H5N1 im Jahr 1997, H1N1 im Jahr 2009 und die beiden Corona-Epidemien Sars im Jahr 2003 und Mers im Jahr 2012. Das Außergewöhnliche ist auf längere Sicht gar nicht so auffällig. Wenn uns die Corona-Pandemie etwas lehrt, dann die Verpflichtung vorauszusehen, was auch unerwartet hereinbrechen kann.
Was schlagen Sie vor?
Wir brauchen nicht nur ein Konjunkturprogramm zur wirtschaftlichen Wiederbelebung, eine gut geplante Rücknahme der drastischen Einschränkungen staatsbürgerlicher Rechte, sondern auch eine neue Justierung, was uns öffentliche Daseinsvorsorge wert ist. Diese Frage geht über die Coronakrise hinaus. Pandemien hat die Menschheit als Ganzes bisher immer noch überlebt. Beim Klimawandel sind dagegen tatsächlich apokalyptische Entwicklungen möglich. Der Anstieg der Luft- und Meerestemperatur und des Meeresspiegels kann Prozesse auslösen, die nicht mehr umkehrbar sind und das Leben auf der Erde radikal verändern. Mehr noch als in der Coronakrise wird die Menschheit bei der Klimakrise beweisen müssen, dass sie zu vorausschauendem Handel fähig ist. Was wir deshalb gerade in Krisen brauchen, ist eine Politik, die besonnen über den Tag hinaus denkt, die Risiken abwägt, auch die außergewöhnlichen, und Verantwortung für Staat und Gemeinwesen übernimmt.
Ist eine solche besonnene Politik durch zunehmende Irrationalität gefährdet?
Ja und nein. Ja, weil Krisen und Katastrophen seit jeher die Suche nach irrationalen Erklärungen fördern. Die beiden Pestepidemien zwischen dem 14. und 18. Jahrhundert galten auch als Zeichen göttlichen Zorns. Statt den Grund für die tödlichen Erkrankungen zu suchen, suchten die Menschen nach Schuldigen. Juden und Frauen waren beliebte Sündenböcke. Auf diese destruktive Angst im Angesicht von Not und Verzweiflung hat Europa schon einmal eine Antwort gefunden: den rationalen Diskurs, die Überprüfung jeder These anhand von Argumenten und Belegen. Bisher haben die irrationalen Erklärungen auch noch keine Mehrheiten gefunden. Ich halte auch nichts davon, andere und seien es auch abwegige Meinungen zu verbieten. Das ist im Grunde anti-demokratisch. In einer demokratischen Öffentlichkeit führt kein Weg an einem rationalen Diskurs vorbei. Langfristig setzt sich die Vernunft immer wieder durch, wobei es zeitweise zu schwerer Irrationalität kommen kann. Aber Irrungen und Wirrungen – so meine Überzeugung – lassen sich nicht durch Verbote aus der Welt schaffen.