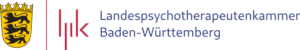BPtK-Empfehlungen: Erste Hilfe für Menschen in schweren psychischen Notsituationen
(BPtK) Psychische Hochs und Tiefs kennt fast jede*. Auch psychische Erkrankungen sind häufig. Mehr als jede vierte Erwachsene* in Deutschland (27,8 Prozent) ist jedes Jahr an einer psychischen Störung erkrankt. Im Laufe eines Lebens erkrankt fast jede zweite Deutsche* an einer psychischen Störung (42,6 Prozent). Rund ein bis zwei Prozent der deutschen Bevölkerung ist schwer psychisch krank. Das sind zum Beispiel häufig psychotisch kranke Menschen. Sie können in Krisen unter außerordentlichen Ängsten leiden oder den Kontakt zur Realität verlieren. Psychotisch kranke Menschen können sich dann bedroht und verfolgt fühlen und sind in einem seelischen Notzustand. Es ist dann sehr wichtig, sie zu beruhigen und Hilfe anzubieten.
„Die allermeisten Menschen mit psychischen Erkrankungen sind friedfertig“, stellt Dr. Dietrich Munz, Präsident der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) fest. „Entscheidend ist, auf Menschen in psychischen Notlagen richtig zu reagieren.“ Erste Hilfe ist auch bei schweren psychischen Notsituationen möglich. Insbesondere Polizei und Einsatzkräfte sollten in der richtigen Gesprächsführung mit psychisch kranken Menschen geschult sein. Psychosoziale Krisendienste können Familien, die nicht mehr allein zurechtkommen, schnell und qualifiziert helfen. Aber auch jede einzelne Bürger*in kann durch richtiges Verhalten dazu beitragen, dass Menschen in psychischen Notlagen Hilfe bekommen und Krisensituationen nicht eskalieren.
Erste-Hilfe-Empfehlungen für Menschen in schweren psychischen Notsituationen
Die Bundespsychotherapeutenkammer empfiehlt folgende Regeln, um Menschen in schweren psychischen Krisen, insbesondere mit Angst- und Wahnvorstellungen, unmittelbar zu unterstützen.
Professionelle Hilfe rufen
-
Wenn Sie den Eindruck haben, dass die Person sich selbst oder andere gefährdet, rufen Sie die Polizei oder den Rettungsdienst an – oder noch besser einen psychosozialen Krisendienst. Nicht in jeder Region gibt es einen Krisendienst. Sie können dies aber herausfinden, indem sie den Namen der Stadt zusammen mit dem Stichwort „Krisendienst“ googeln. Schildern Sie, dass eine Person aufgrund einer psychischen Notlage dringend Hilfe braucht. Fragen Sie bei der Polizei nach Beamt*innen, die mit Menschen in psychischen Notlagen Erfahrung haben.
Vorsichtig ein Gespräch anbieten, abwarten und beruhigen
-
Überlegen Sie, ob eine Kontaktaufnahme möglich ist. Bedenken Sie, dass die Person sich möglicherweise bedroht oder verfolgt fühlt und deshalb auch eine Annäherung als Bedrohung erleben kann.
-
Wenn Ihnen die Situation nicht geheuer ist, halten Sie Abstand und warten ab, bis professionelle Hilfe da ist.
-
Nähern Sie sich nicht, ohne zu fragen, ob dies der Person recht ist. Reagiert Ihr Gegenüber verängstigt oder aggressiv, ziehen Sie sich wieder zurück. Verstellen Sie der Person keine „Fluchtwege“, zum Beispiel Ausgänge. Auch das könnte sie als Bedrohung erleben.
-
Drängen Sie nicht. Lassen Sie Ihrem Gegenüber Zeit, sich zu beruhigen und zu antworten. Allein Ihre Anwesenheit kann beruhigen.
-
Wenn andere Menschen da sind, sorgen Sie dafür, dass immer nur eine Person spricht. Kreisen Sie die Person nicht ein.
-
Erkundigen Sie sich, ob Sie Familie, Freund*innen oder eine behandelnde Ärzt*in oder Psychotherapeut*in benachrichtigen können. Warten Sie ab, ob Ihr Gegenüber Hilfe annehmen kann. Hilfe zu holen, ist das Beste, was Sie tun können.
-
Wenn die Person Ihnen Dinge schildert, dass sie zum Beispiel von Außerirdischen verfolgt wird, eine große Katastrophe droht oder sie „Jesus Christus“ ist, nehmen Sie die Schilderungen ernst. Solche bizarren oder ungewöhnlichen Vorstellungen sind für die Person real. Versuchen Sie, die Person nicht zu beruhigen, indem Sie sagen, dass Sie gar keine Außerirdischen sehen können. Hören Sie einfach zu. Bieten Sie an, bei ihr zu bleiben, bis Hilfe kommt. Lassen Sie zu, wenn sich die Person zurückzieht.
-
Lenken Sie das Gespräch auf andere Themen. Fragen Sie zum Beispiel nach, ob Ihr Gegenüber Durst hat oder etwas trinken möchte.
-
Bewegen Sie sich nicht plötzlich oder schnell. Kündigen Sie an, was Sie machen. Fragen Sie zum Beispiel nach, ob es in Ordnung ist, wenn Sie jetzt versuchen, Angehörige anzurufen.
-
Gefährden Sie sich nicht selbst. Sorgen Sie stets für Ihre eigene Sicherheit oder die Sicherheit anderer in der Situation. Achten Sie darauf, dass auch Ihnen ein Fluchtweg bleibt.
Pressehintergrund: Psychische Erkrankungen und Gewalt
Es ist sehr viel wahrscheinlicher, von einem psychisch gesunden als von einem psychisch kranken Menschen verletzt zu werden. Das allgemeine Risiko in Deutschland, durch ein Gewaltverbrechen zu sterben, lag im Jahr 2019 bei ungefähr eins zu 160.000. Das Risiko, durch die Gewalttat eines psychisch kranken Menschen zu sterben, liegt dagegen nur bei etwa eins zu eineinhalb Millionen und ist damit verschwindend gering.
„Bei der Berichterstattung über einzelne psychisch kranke Gewalttäter*innen entsteht schnell der Eindruck, dass alle psychisch kranken Menschen gefährlich sind“, stellt BPtK-Präsident Munz fest. „Dies führt aber dazu, dass insbesondere schwer psychisch kranke Menschen scheuen, sich Hilfe bei Psychotherapeut*innen oder Ärzt*innen zu suchen, weil sie befürchten, sonst für Gewalttäter*innen oder, wie es eine Patientin formulierte, für ‚Monster‘ gehalten zu werden. Der wirksamste Schutz vor Gewalt ist aber das frühe Erkennen und Behandeln von schweren psychischen Erkrankungen. Eine rechtzeitige und ausreichende Behandlung senkt das Gewaltrisiko drastisch.“ Die BPtK hat deshalb einen Pressehintergrund „Psychische Erkrankungen und Gewalt“ zusammengestellt. Damit lassen sich insbesondere die Risiken besser einschätzen, die psychisch kranke Menschen für andere darstellen.