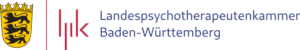BPtK-Round-Table zur Suizidassistenz
(BPtK) Das Bundesverfassungsgericht hat am 26. Februar 2020 geurteilt, dass es ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben mit der Unterstützung durch Dritte gibt. Dieses Urteil zur Suizidassistenz hat die gesellschaftliche und politische Debatte zum selbstbestimmten Sterben erneut entfacht. Damit steht auch das Verbot der geschäftsmäßigen Hilfe zum Suizid aus dem Jahr 2015 zur Diskussion. Die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) hat am 29. Juni 2021 das Thema auf einem Round Table innerhalb der Profession erörtert.
Zentrale Frage bei der Suizidassistenz sei immer die Abwägung zwischen Autonomie und Schutz der Sterbewilligen, stellt BPtK-Präsident Dr. Dietrich Munz fest. Dabei sei eine gängige Auffassung, dass Voraussetzung für eine freie, verantwortliche Entscheidung zum Suizid die psychische Gesundheit der Sterbewilligen* sei. Aus seiner Sicht könne jedoch auch psychisch kranken Menschen eine Suizidassistenz nicht verwehrt werden, da auch sie einen freien und autonom gebildeten Sterbewillen unabhängig von ihrer Symptomatik fassen können. Er sehe die Profession in der Verantwortung, sich über die Beratung und Begutachtung von Sterbewilligen, inklusive der berufsethischen Dimensionen, eine Meinung zu bilden. Letztlich müsse dann darauf aufbauend jede Psychotherapeut*in für sich entscheiden, welche Haltung sie zur Suizidassistenz einnehme.
Ein wegweisendes Urteil für die Suizidassistenz?
Prof. Dr. Steffen Augsberg, Professor für öffentliches Recht an der Universität Gießen, ordnete das Urteil des Bundesverfassungsgerichts und seine Folgen für die Gesetzgebung ein. Die Suizidassistenz stehe immer im Spannungsfeld zwischen Lebensschutz und Selbstbestimmung. Dieses Spannungsfeld sei gesetzgeberisch kaum aufzulösen. Schutzkonzepte erforderten Regulierung. Sollten aber Freiräume trotzdem offenbleiben, dürfe man wiederum nicht zu effektiv regulieren. Je stärker reguliert werde, desto mehr werde der Staat in Verantwortung genommen. „Regulierung heißt auch legitimieren“, erläuterte Augsberg. Dabei sei das Recht auf Selbsttötung unter Rechtswissenschaftler*innen Konsens. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts sei zu diesem Punkt keine wegweisende Entscheidung gewesen. Für ihn führe das Urteil zu einer Überbetonung der Autonomie, die sich fast als Heroisierung oder Fetischisierung des Suizids lese. Grundsätzlich ergebe sich für den Gesetzgeber nicht zwingend ein Regelungsbedarf aus dem Urteil. Sollte der Gesetzgeber tätig werden, müsse er klare Verfahrensregeln schaffen, die aber nicht nur auf Ausnahmesituationen, wie einer bestehenden Krankheit, fußen dürfen. Es bestehe das Recht, sich aus freiem Willen zum Suizid zu entscheiden und dabei auf Assistenz zurückzugreifen.
Dabei sei zu berücksichtigen, dass die informierte Entscheidung oft eine Illusion sei, da sie von verschiedenen Faktoren abhängig sei, unter anderem von der Fähigkeit zu verstehen, von der Vulnerabilität der Person, ihrer Behandlungsbedürftigkeit, aber auch ihrem Vertrauen in die Behandelnde*. Daher gebe es eine von vornherein fragile Grundvorstellung von Autonomie. Die Beantwortung der Frage, ob ein Mensch nicht mehr oder nicht so leben wolle, sei kontextabhängig. Dies könne nur darüber gelöst werden, dass man mit den Sterbewilligen über Alternativen spreche, das heißt, Beratung anbiete, begutachte, ob eine psychische Erkrankung das Potenzial hat, die Selbstbestimmung zu gefährden, und eine Wartezeit bis zur Umsetzung des Suizids vorgesehen werde. Es gehe um die verfahrensrechtliche Absicherung der autonomen Entscheidung. Augsberg machte deutlich, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen nicht vom Zugang zur Suizidassistenz ausgeschlossen werden können, da auch sie freiverantwortliche Entscheidungen fassen können. Es dürfe nicht zu einer Überpathologisierung von Menschen mit psychischen Erkrankungen kommen, gerade deshalb sei die Begutachtung wesentlich. Kontrovers sei die Frage, ob Minderjährige von der Suizidassistenz ausgeschlossen werden können, da ihnen in einigen Fällen die Einwilligungsfähigkeit zugesprochen, in anderen aber abgesprochen werde. Da der Suizid nicht revidierbar sei, stelle sich die Frage, ob Minderjährige diese Entscheidung tatsächlich treffen dürfen sollten.
Kein Druck auf vulnerable Menschen
Konterkariert die Suizidassistenz die Suizidprävention? Nach Ansicht von Prof. Dr. Dr. Sigrid Graumann, Professorin für Ethik an der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe, ist dies ein Konflikt, der nur in der Praxis aufgelöst werden kann. Es sei wichtig davon auszugehen, dass der abgewogene, selbstbestimmte und dauerhafte Wunsch zu sterben (Bilanzsuizid) nicht der Normalfall sei. Für die meisten Menschen sei der Wunsch zu sterben das Ergebnis langwieriger, einengender und belastender Prozesse, die dazu führen, dass ein Mensch „das Leben nicht mehr ertragen“ wolle. Die Vulnerabilität von Menschen mit psychischen Erkrankungen oder mit Behinderungen müsse berücksichtigt werden. Insbesondere die strukturelle Unterfinanzierung der sozialpsychiatrischen Versorgung müsse dringend behoben werden, um möglichen negativen Effekten einer Suizidassistenz entgegenzuwirken. Daher müsse die Suizidprävention Vorrang haben und dürfe nicht mit der Beratung zur Suizidassistenz vermischt werden.
Es gehe darum, Alternativen aufzuzeigen und Perspektiven zu schaffen. Der gesellschaftliche Druck auf vulnerable Gruppen dürfe unter keinen Umständen noch mehr erhöht werden. Unterstützung sei für vulnerable Menschen zentral für ihre Lebensqualität. Bei psychisch kranken Menschen könne die Freiverantwortlichkeit eingeschränkt sein oder Suizidalität periodisch auftreten, sodass eine Abgrenzung bei der Begutachtung herausfordernd sein könne. Wenn der Suizid Ausdruck des selbstbestimmten Lebens sei, stelle sich zudem die Frage, ob Suizidprävention überhaupt legitim ist? Nach Ansicht von Graumann setze Suizidprävention voraus, dass man die Vermeidung des assistierten Suizids als Ziel annehme und ein Verständnis von relationaler Autonomie habe. Suizidprävention müsse daher auf institutioneller und gesellschaftlicher Ebene stattfinden. Die Versorgungsangebote müssten gestärkt, Unter- und Überversorgung abgebaut sowie Teilhabe und Selbstbestimmung in Behinderten- und Pflegeeinrichtungen gestärkt werden. Gesellschaftlich müsse die Lebensleistung mehr anerkannt und ein Leben mit Beeinträchtigungen wertgeschätzt werden.
Freiverantwortlichkeit bei Menschen mit psychischen Erkrankungen voraussetzen
PD Dr. med. Dr. phil. Manuel Trachsel, Abteilungsleiter Klinische Ethik am Universitätsspital Basel, stellte heraus, dass die Suizidassistenz im Spannungsfeld zwischen Autonomie und Fürsorgepflicht stehe. Dabei sei zu bedenken, dass insbesondere bei der Begutachtung von psychisch kranken Menschen voreilig angenommen werden könne, dass die Freiverantwortlichkeit nicht gegeben sei. Die eigene Grundeinstellung zu reflektieren sei daher zentral. Eine Umfrage unter Schweizer Psychiater*innen habe gezeigt, dass die Einstellung zur Suizidassistenz für Menschen mit psychischen Erkrankungen breit gefächert sei und sich keine mehrheitliche Befürwortung oder Ablehnung ablesen lasse. Rechtlich stehe aber fest, dass sie auch bei psychischen Erkrankungen nicht verweigert werden dürfe. Grundsätzlich müsse berücksichtigt werden, dass Leid subjektiv, nicht objektivierbar und höchstens nachvollziehbar sein könne. Die Ursache für das individuelle Leid sei nicht relevant und lasse daher auch ethisch keine Diskriminierung von psychisch kranken Menschen zu.
In der Schweiz diskutiere man als Voraussetzung für den assistierten Suizid drei Aspekte: Unerträgliches Leid, Behandlungsresistenz und Freiverantwortlichkeit. Für psychisch kranke Menschen sei festzuhalten, dass unerträgliches Leid selbstverständlich körperlicher oder psychischer Natur sein könne. Kritisch zu hinterfragen sei das Kriterium der Behandlungsresistenz: In der psychiatrischen und psychotherapeutischen Versorgung gebe es anders als in der Somatik keine Definition, wann eine Therapieresistenz bestehe oder dass es absehbar keine positive Langzeitprognose geben könne. Bei psychischen Erkrankungen gebe es kein Modell der „letzten Krankheitsstufe“. Von Freiverantwortlichkeit könne gesprochen werden, wenn Einsichtsfähigkeit und Urteilsfähigkeit oder Steuerungsfähigkeit bestehen. Informationen müssten verstanden werden, ihre Bedeutung erfasst und in Handeln umsetzbar sein. In einer Abwägung möglicher Alternativen werde eine rationale Gewichtung vorgenommen, die in einer Entscheidungsfindung münde. Grundsätzlich müsse auch bei Menschen mit psychischen Erkrankungen davon ausgegangen werden, dass sie einsichts- und urteilsfähig sind. Die Diagnose könne nur als Anhaltspunkt für einen Zweifel gesehen werden. Der Wechsel von Symptomen bei psychischen Erkrankungen könne die Freiverantwortlichkeit beeinflussen, weshalb eine Bewertung zu verschiedenen Zeitpunkten notwendig sei, auch um die Dauerhaftigkeit des Sterbewillens zu prüfen. Anerkannt werden müsse auch, dass es das Recht gebe, unvernünftige Entscheidungen oder Gründe anzuführen. Dies könne zwar Anlass für einen Zweifel an der Freiverantwortlichkeit, nicht jedoch Grund für eine Beschränkung des Zugangs zur Suizidassistenz sein. Die Begutachtung dürfe daher nicht von den persönlichen Auffassungen der Begutachtenden abhängig sein. Wer sich stark für oder gegen die Suizidassistenz positioniert, sollte daher von einer Begutachtung Abstand nehmen.
Psychotherapeut*innen begrüßen breite Diskussion zur Suizidassistenz
Dr. Nikolaus Melcop, Vizepräsident der BPtK, lud zur Diskussion der Suizidassistenz aus psychotherapeutischer Sicht ein. Wie lassen sich das professionelle Anliegen der Suizidprävention einerseits und der Zugang zu einem assistierten Suizid andererseits in psychotherapeutisches Handeln integrieren? Wie lassen sich die Rahmenbedingungen für Suizidprävention verbessern und so gestalten, dass sie die Möglichkeiten für Suizidassistenz sinnvoll ergänzen? Wo sollten Psychotherapeut*innen in die Beratung und Begutachtung von Sterbewilligen eingebunden werden? Welche Herausforderungen bestehen in der Begutachtung und benötigt es hierfür zusätzliche Qualifikationen?
Viele Diskussionseilnehmer*innen plädierten dafür, dass Psychotherapeut*innen sich als Expert*innen für psychische Erkrankungen in die Beratung und Begutachtung von Sterbewilligen einbringen. Psychotherapeut*innen seien bestens für das Erkennen und Diagnostizieren von psychischen Erkrankungen ausgebildet und könnten ebenso bewerten, ob es Einschränkungen der Freiverantwortlichkeit gebe. Betont wurde, dass Psychotherapie stark am Autonomiegedanken ansetze, deshalb dürfe sich die Profession nicht der Auseinandersetzung mit ihrer Rolle in der Suizidassistenz entziehen. Existenzielle Fragen stellten sich häufig im psychotherapeutischen Setting und Psychotherapeut*innen beraten in diesen Situationen, um Einengungen aufzulösen und Perspektiven zu schaffen. Dazu gehöre aber auch die Auseinandersetzung mit dem Tod sowie die Motivation von Sterbewilligen zu verstehen, auch wenn diese bisher, auch aufgrund haftungsrechtlicher Aspekte, primär suizidpräventiv beantwortet werde. Komplex sei auch die Frage, ob Minderjährigen der Zugang zu Suizidassistenz verwehrt bleiben dürfe. Gefordert wurde zu klären, in welchen Strukturen die Beratung Sterbewilliger am besten ausgestaltet werden könne und auch, wie eine unabhängige und qualitätsgesicherte Begutachtung sichergestellt werden kann. Hierfür seien Fortbildungsangebote zentral. In der Debatte zur Suizidassistenz müssten Psychotherapeut*innen sich jedoch gleichermaßen für eine starke Suizidprävention einsetzen. Festgehalten wurde, dass es wichtig sei, dass die berufsethische Auseinandersetzung mit der gesamten Profession fortgeführt und intensiviert werde.