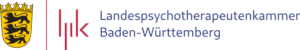G-BA beschließt Richtlinie für Versorgung in multiprofessionellen Netzverbünden
(BPtK) Für Erwachsene mit schweren psychischen Erkrankungen hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) eine neue ambulant-intensive Komplexbehandlung geregelt. Die neue Richtlinie soll eine aufeinander abgestimmte multiprofessionelle Behandlung und Betreuung sicherstellen. Künftig kann dadurch den oft chronisch kranken Patient*innen mit wiederkehrenden psychischen Krisen ein intensivtherapeutisches Angebot gemacht und ein stabileres und selbstständigeres Leben unterstützt werden, sodass stationäre Behandlungen möglichst vermieden werden. Dafür schließen sich Psychotherapeut*innen und Ärzt*innen in regionale Netzverbünden zusammen, die enge Kooperationen mit Krankenhäusern, ambulanter psychiatrischer Pflege, Soziotherapeut*innen und Ergotherapeut*innen vereinbaren. Die Patient*innen können eine Psychotherapeut*in oder Ärzt*in als zentrale Ansprechpartner*in wählen, die für sie die gesamte Behandlung plant („Bezugspsychotherapeut*in, -ärzt*in“).
Welche Patient*innen können teilnehmen?
Das neue Versorgungsangebot richtet sich an Erwachsene mit der Diagnose einer schweren psychischen Erkrankung (F1 bis F9 nach ICD-10 und GAF-Wert ≤ 50), die durch mindestens zwei verschiedene Berufsgruppen behandelt werden müssen. Die GAF-Skala ist eine international wissenschaftlich anerkannte Klassifikation zur Beschreibung der psychischen, sozialen und beruflichen Einschränkungen von psychisch erkrankten Menschen.
Netzverbünde organisieren die Versorgung
Für einen regionalen Netzverbund müssen vor Ort mindestens zehn Psychotherapeut*innen und Fachärzt*innen einen Vertrag schließen, mit dem sie eine ambulante Komplexbehandlung vereinbaren. Davon müssen jeweils mindestens vier Psychiater*innen oder Psychosomatiker*innen und vier Psychotherapeut*innen sein. Der Verbund muss außerdem Kooperationsverträge mit mindestens einem psychiatrischen Krankenhaus (mit regionaler Versorgungsverpflichtung) und mit mindestens einer zugelassenen Soziotherapeut*in, Ergotherapeut*in oder ambulanten psychiatrischen Pflegekraft abschließen. Netzverbund- und Kooperationsverträge sind den Kassenärztlichen Vereinigungen zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen. Für Patient*innen und Zuweiser*innen veröffentlichen die Kassenärztlichen Vereinigungen ein öffentliches Verzeichnis der Netzverbünde und deren Mitglieder.
An wen können sich die Patient*innen wenden?
Patient*innen können sich direkt an eine Netz-Psychotherapeut*in oder Netz-Psychiater*in wenden. Sie können auch von einer niedergelassenen Ärzt*in oder Psychotherapeut*in an sie überwiesen oder von einem Krankenhaus oder dem Sozialpsychiatrischen Dienst empfohlen worden sein. Sie sollen dann innerhalb von sieben Werktagen einen Sprechstunden-Termin erhalten. In dieser „Eingangssprechstunde“ wird abgeklärt, ob die Voraussetzungen für eine Komplexbehandlung vorliegen. Bei Psychotherapeut*innen geschieht dies in der regulären psychotherapeutischen Sprechstunde. Diese schließt zwar bereits eine differenzialdiagnostische Abklärung mit ein. Nicht zuletzt zur somatischen Abklärung soll jedoch zusätzlich eine vollständige differenzialdiagnostische Abklärung bei einer Psychiater*in oder Psychosomatiker*in durchgeführt werden. Diese differenzialdiagnostische Abklärung soll innerhalb von weiteren sieben Werktagen erfolgen.
Damit müssen nicht immer sowohl eine Psychotherapeut*in als auch eine Psychiater*in als „Behandlungsteam“ zusammenarbeiten, wie es die Kassenärztliche Bundesvereinigung vorgeschlagen hatte. In der Praxis dürften die Behandlungsbedarfe jedoch solche Teams in der Regel notwendig machen.
Bezugspsychotherapeut*in und Gesamtbehandlungsplan
Die Bezugspsychotherapeut*in oder Bezugsärzt*in erstellt auf der Basis der Eingangs- und Differenzialdiagnostik einen „Gesamtbehandlungsplan“. Der Plan beschreibt die erforderlichen psychotherapeutischen, ärztlichen und medikamentösen Leistungen, aber auch die Leistungen anderer Gesundheitsberufe und Einrichtungen sowie Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe. Er wird zu Behandlungsbeginn mit allen beteiligten Personen und Einrichtungen abgestimmt. Dazu gehört stets auch ein „Kriseninterventionsplan“.
Die Patient*in entscheidet zu Beginn der Behandlung, wer ihre zentrale Ansprechperson sein soll. Die Verantwortung für den Gesamtbehandlungsplan muss jedoch bei einer Bezugsärzt*in liegen, wenn somatische Hauptdiagnosen im Vordergrund der Behandlung stehen und einer kontinuierlichen Überwachung bedürfen oder wenn die psychopharmakologische Behandlung regelmäßige Dosisanpassungen erfordert. Bereits begonnene Behandlungen bei Ärzt*innen oder Psychotherapeut*innen, die nicht zum Netzverbund gehören, können fortgesetzt werden. Dafür müssen sie dem Gesamtbehandlungsplan zustimmen und an den Fallbesprechungen teilnehmen. In den Fallbesprechungen soll regelmäßig geprüft werden, ob die Therapieziele erreicht werden, weitere Leistungen notwendig sind oder der Gesamtbehandlungsplan angepasst werden muss.
Eine Bezugsärzt*in oder -psychotherapeut*in kann allerdings nur Netzmitglied werden, wenn sie über einen vollen Versorgungsauftrag verfügt. Angesichts der häufigen Teilung von Versorgungsaufträgen könnte dies zu erheblichen Engpässen beim Aufbau der ambulanten Komplexbehandlung führen. In manchen Kassenärztlichen Vereinigungen verfügen bis zwei Drittel der Vertragspsychotherapeut*innen über einen halben Versorgungsauftrag. Diese Bedingung wurde insbesondere damit begründet, dass die zentrale Ansprechpartner*in der Patient*in ausreichend erreichbar sein sollte. Berufsausübungsgemeinschaften, aber auch Praxisgemeinschaften erfüllen in der Regel diese Voraussetzungen.
Unterstützung der Patient*innen während der Versorgung
Die konkrete Koordination der Leistungen, die eine Patient*in erhalten soll, muss vollständig an eine „nichtärztliche Person“ delegiert werden. Diese soll Termine vereinbaren, den Informationsaustausch im Behandlungsteam organisieren, ein Rückmeldesystem zur Termineinhaltung einrichten, aber auch die Patient*in aufsuchen. Dies kann beispielsweise eine zugelassene Soziotherapeut*in oder ambulant tätige psychiatrische Krankenpflegekraft übernehmen oder Personal, das in einer Praxis oder vom Netzverbund angestellt ist und über eine fachspezifische Qualifikation in der Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen verfügt.
Die verpflichtende Delegation der Koordinationsaufgaben widerspricht den Grundsätzen der medizinischen Versorgung. Bei Bedarf und fachlicher Notwendigkeit müssen Bezugspsychotherapeut*innen und -ärzt*innen Koordinationsaufgaben auch selbst übernehmen können. Fachlich unsinnig ist es ferner, nicht auch Psychotherapeut*innen und Ärzt*innen eine aufsuchende Behandlung zu ermöglichen, um zum Beispiel eine drohende Krankenhausbehandlung abzuwenden. Deshalb ist ein solches Home-Treatment durch Psychotherapeut*innen und Ärzt*innen auch bei der stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung aus dem Krankenhaus heraus vorgesehen. Der Ausschluss der Heilberufler*innen ignoriert auch, dass in manchen Regionen sozio- und ergotherapeutische Angebote bei psychischen Erkrankungen und ambulante psychiatrische Pflege nur sehr eingeschränkt existieren. Gerade in strukturschwachen und ländlichen Regionen könnte so der Aufbau einer wohnortnahen, ambulanten Komplexbehandlung unnötig erschwert sein oder unmöglich gemacht werden.
Gesetzlicher Hintergrund und Ausblick
Der G-BA war mit der gesetzlichen Reform der Psychotherapeutenausbildung am 15. November 2019 beauftragt worden, eine berufsgruppenübergreifende, koordinierte und strukturierte Versorgung, insbesondere für schwer psychisch kranke Versicherte mit einem komplexen psychiatrischen oder psychotherapeutischen Behandlungsbedarf zu regeln.
Die Richtlinie zur ambulanten Komplexversorgung wird nun innerhalb von zwei Monaten vom Bundesgesundheitsministerium rechtlich geprüft. Die BPtK fordert, dass das Bundesgesundheitsministerium im Zuge seiner Rechtsaufsicht über Auflagen die kritischen Punkte korrigiert, die eine ausreichende Umsetzung der ambulanten Komplexbehandlung zu verhindern drohen. Nach einer Genehmigung hat der Bewertungsausschuss sechs Monate Zeit, den Einheitlichen Bewertungsmaßstab anzupassen und die Vergütung für die neuen Leistungen zu regeln. Danach könnten in der zweiten Jahreshälfte 2022 die ersten Netzverbünde ihre Arbeit aufnehmen.
Darüber hinaus wird der G-BA demnächst die Beratungen für eine Regelung für die ambulante Komplexbehandlung von Kindern und Jugendlichen mit schweren psychischen Erkrankungen aufnehmen.