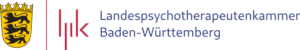Erhebliche Defizite in der Versorgung von Menschen mit Depressionen
Nur rund sechs Prozent der Patient*innen erhalten eine Psychotherapie
(BPtK) Die Behandlung von Menschen mit Depressionen in Deutschland weist weiterhin große Mängel auf: Eine Psychotherapie (Kurzzeit oder Langzeit) erhalten nur 6,2 Prozent aller depressiven Patient*innen und 10,2 Prozent der schwer depressiven Patient*innen. Antidepressive Medikamente nehmen 42 Prozent aller Patient*innen mit Depressionen und 60,3 Prozent der Patient*innen mit schweren Depressionen ein. Der Großteil der Patient*innen erhält ihre Diagnose vom Hausarzt (78,3 %). Bei einem weitaus geringeren Anteil werden die Symptome durch spezielle Behandler*innen eingeschätzt: bei knapp jeder fünften Person (18,7 %) durch Psychiater*innen oder Neurolog*innen und bei nur jeder zwanzigsten Person (5,1 %) durch Psychotherapeut*innen.
Dies ist das Ergebnis der bislang umfangreichsten bundesland-weiten Studie zur Versorgung von Menschen mit Depressionen, die die AOK Niedersachsen in Kooperation mit Expert*innen der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), der Leibniz Universität Hannover und der Ostfalia Hochschule Wolfsburg durchgeführt hat. Für die Studie wurden Daten von über 285.000 Personen mit einer Depressionsdiagnose aus dem Jahr 2018 ausgewertet. Von den Diagnostizierten waren zwei Drittel (67,5 %) weiblich. Das durchschnittliche Alter betrug knapp 60 Jahre (57,5).
Diese Befunde bestätigen Ergebnisse des „Faktencheck Depression“ der Bertelsmann-Stiftung aus dem Jahr 2014: Danach erhielten drei von vier Patient*innen (74 %) in Deutschland, die an einer schweren Depression erkrankt sind, keine angemessene Therapie. Mehr als die Hälfte (56 %) der schwer Depressiven wurde unzureichend, 18 Prozent sogar gar nicht behandelt.
Medizinische Leitlinien zur Behandlung von Depressionen empfehlen bei allen Schweregraden einer Depression Psychotherapie, bei schweren Depressionen eine Kombination aus Psychotherapie und Antidepressiva.