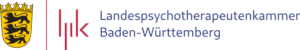Corona-Pandemie: Mehr psychische Erkrankungen bei jugendlichen Mädchen
Aktueller Kinder- und Jugendreport der DAK erschienen
(BPtK) Während der Corona-Pandemie hat die Häufigkeit erstmals diagnostizierter psychischer Erkrankungen bei jugendlichen Mädchen deutlich zugenommen. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle Kinder- und Jugendreport der DAK-Gesundheit, in den die Abrechnungsdaten von rund 800.000 DAK-Versicherten im Alter bis 17 Jahre eingeflossen sind. In der Altersgruppe der 15- bis 17-jährigen Mädchen stieg zwischen 2019 und 2021 die Anzahl neu diagnostizierter Essstörungen (+54 Prozent), Depressionen (+ 18 Prozent) und Angststörungen (+24 Prozent) an. Bei Jungen hat die Häufigkeit von Essstörungen, Depressionen und Angststörungen zwischen 2019 und 2021 hingegen abgenommen. Bei ihnen zeigte sich eine Zunahme der Häufigkeit von Adipositas (15 Prozent).
Während der Corona-Pandemie hat auch der Anteil von jugendlichen Mädchen mit erstmals diagnostizierter Depression, die medikamentös behandelt worden sind, um sechs Prozentpunkte zugenommen (+ 65 Prozent). Ähnliche Tendenzen zeigen sich auch bei der medikamentösen Behandlung von Essstörungen und Angststörungen. Auch der Anteil jugendlicher Mädchen, die aufgrund von Depressionen stationär behandelt werden mussten, hat während der Corona-Pandemie zugenommen. Während 2018 und 2019 noch knapp 15 von 1.000 jugendlichen Mädchen wenigstens einmal aufgrund von Depressionen im Krankenhaus versorgt wurden, lag der Anteil in den Jahren 2020 und 2021 zusammengenommen bei 18 Fällen je 1.000.
„Die DAK-Daten zeigen, dass insbesondere bei jungen Mädchen während der Corona-Pandemie psychische Erkrankungen zugenommen haben, die häufiger als früher medikamentös oder stationär behandelt worden sind. Psychotherapie ist im Kindes- und Jugendalter häufig das Mittel der ersten Wahl bei der Behandlung psychischer Erkrankungen. Wir fordern die Politik auf, ein Sofortprogramm aufzusetzen, damit psychisch kranke Kinder und Jugendliche schneller Zugang zur psychotherapeutischen Versorgung haben und stationäre und medikamentöse Behandlungen weitgehend vermieden werden können“, fordert BPtK-Präsident Dr. Dietrich Munz. „Hierzu gehören die Vereinfachung des Kostenerstattungsverfahrens in der Psychotherapie, eine Reform der Bedarfsplanung mit mehr Psychotherapeutensitzen und die Entwicklung interdisziplinärer Versorgungsformen“.