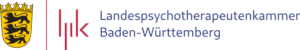BPtK-Workshop zu bereits existierenden Praxismodellen
(BPtK) In den psychiatrischen und psychosomatischen Krankenhäusern besteht bereits jetzt ein akuter Ärztemangel. Das verändert die Rolle der Psychotherapeut*innen in den Kliniken. Psychotherapeut*innen entwickeln sich zu einer entscheidenden Säule der stationären Versorgung. Dies wird sich durch die neue psychotherapeutische Weiterbildung noch verstärken. Die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) hat deshalb am 20. September 2022 einen digitalen Workshop durchgeführt, bei dem bereits existierende Praxismodelle vorgestellt und vor dem Hintergrund der bisherigen rechtlichen Rahmenbedingungen mit den Teilnehmer*innen diskutiert wurden.
„Psychotherapeut*innen zu einer Partner*in auf Augenhöhe für die ärztlichen Kolleg*innen zu machen, erfordert auch, die Frage nach der Einbindung von Psychotherapeut*innen in Bereitschafts- und Notdienste zu diskutieren“, meinte Dr. Georg Kremer, Psychotherapeut und Mitglied des BPtK-Ausschusses „Psychotherapie in Institutionen“ in seiner Einführung.
Praxismodelle
Im Evangelischen Klinikum Bethel in Bielefeld entlasten Psychotherapeut*innen bereits seit 2017 ihre ärztlichen Kolleg*innen bei der Aufnahme der Patient*innen und bei Kriseninterventionen nach Ende der regulären Arbeitszeit. „Die Dienste sind zunächst befristet eingeführt worden“, erläuterte Svenja Papenbrock, leitende Psychotherapeut*in in Bielefeld. „Die anfängliche Skepsis bei den Kolleg*innen – ärztlichen wie psychotherapeutischen – ist jedoch schnell gewichen.“ Die Erfahrung, dass Psychotherapeut*innen den Diensten gut gewachsen seien, hätte dazu geführt, dass diese Dienste in die Regelversorgung überführt worden sind. Für die Dienste verschiebt sich die reguläre Arbeitszeit der diensthabenden Psychotherapeut*in circa einmal monatlich auf 13 bis 22 Uhr. Der Dienst der Krisenintervention beginnt dann ab 17 Uhr. Gemeinsam mit der diensthabenden Pflegefachperson und Ärzt*in ist die Psychotherapeut*in für alle akuten Anfragen und Aufnahmen zuständig, die ohne Termin von außen kommen.
In der Kinder- und Jugendpsychiatrie Riedstadt übernehmen Psychotherapeut*innen 24-stündige Bereitschaftsdienste. In diesem Dienst ist die Psychotherapeut*in für alle Krisen- und Notfälle zuständig. Eine Oberärzt*in ist im Hintergrunddienst jederzeit telefonisch erreichbar und kommt, wenn erforderlich, in die Klinik. „Dies kommt aber äußerst selten vor“, stellt Susanne Rosenzweig, leitende Psychotherapeutin in Riedstadt, fest. Für die Verschreibung von Medikamenten hat die Oberärzt*in auch von außerhalb Zugriff auf das Dokumentationssystem der Klinik. In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle lassen sich die Krisensituationen aber psychotherapeutisch auffangen.
Ähnliche Erfahrungen liegen aus der Allgemeinpsychiatrie des St. Elisabeth Krankenhauses Gerolstein vor. In einem Pilotprojekt konnte die Einführung des psychotherapeutischen Bereitschaftsdienstes dort sogar dazu beitragen, Fixierungen und Zwangsmaßnahmen zu verringern. „Psychotherapeutische Interventionen sind in Krisensituationen ungemein hilfreich und können wesentlich zur Deeskalation beitragen – auch bei Notaufnahmen in der Nacht“, ist Yvonne Hoffmeister, leitende Psychotherapeutin des St. Elisabeth Krankenhauses, überzeugt.
Die Beispiele verdeutlichten, dass Psychotherapeut*innen über die notwendigen Kompetenzen zur Übernahme von Diensten verfügen. Diese Erfahrung macht auch die psychosomatische Sonnenbergklinik in Stuttgart seit ihrer Gründung. Dort seien Psychotherapeut*innen gleichberechtigt mit ihren ärztlichen Kolleg*innen in den Wochenend-Bereitschaftsdienst eingebunden, unterstützt durch einen oberärztlichen Hintergrunddienst, berichtete Dr. Dietrich Munz, Präsident der BPtK.
Selbstverständnis als „Versorger“
Die Praxismodelle machen deutlich, dass zum Selbstverständnis der Psychotherapeut*innen neben der psychotherapeutischen Behandlung der Patient*innen auch die Verantwortung für die Übernahme von Diensten, zum Beispiel in der Nacht, zählen kann.
Alle Referent*innen sahen sich in der gemeinsamen Verantwortung für die gesamte Versorgung der Patient*innen. Dieses breitere Selbstverständnis unterstützte auch der ärztliche Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Reutlingen. Für Psychotherapeut*innen, die im Krankenhaus arbeiten, müsste es in Zukunft normal sein, sich an allen Aufgaben eines Krankenhauses zu beteiligen – und hierzu gehöre die Versorgung der Patient*innen 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche.
Entscheidend sind Approbation und persönliche Kompetenz
Voraussetzung für die Einbindung von Psychotherapeut*innen in Dienste des Krankenhauses sollten aus fachlichen, aber auch aus rechtlichen Gründen die Approbation als Psychotherapeut*in und die persönliche Kompetenz sein, so Dr. Martin Liebig, Syndikusanwalt eines großen Klinikträgers. Der Gesetzgeber lasse dem Krankenhaus weitgehende Spielräume für die fachliche Organisation der Behandlung. Das Krankenhaus sei verpflichtet, den fachlichen Standard jederzeit zu gewährleisten. Für die psychotherapeutische Behandlung sei dieser Standard – auch in Bereitschaftsdiensten – durch eine approbierte Psychotherapeut*in gewährleistet. Das Krankenhaus habe aber dafür Sorge zu tragen, dass die Schnittstelle zur somatischen und psychopharmakologischen Behandlung organisatorisch so gestaltet sei, dass auch hier der fachliche Standard gewährleistet ist. Die Sicherstellung jederzeit verfügbarer fachärztlicher Expertise durch einen Hintergrunddienst könne deshalb ausreichend sein.
Diskussion
In der Diskussion wurde deutlich, dass nicht in allen Kliniken die notwendigen Rahmenbedingungen für die Übernahme von Diensten geboten werden. So berichtete eine Kolleg*in, dass sie aufgrund ständiger Personalausfälle in ihrer Klinik sowohl in der ärztlichen als auch in der psychotherapeutischen Berufsgruppe immer wieder für bis zu 30 Patient*innen im Tag- und im Bereitschaftsdienst allein zuständig sei. Die Übernahme der Nachtdienste gingen zudem zulasten der psychotherapeutischen Behandlung am Tag, die dann entfallen müssten. Auch andere Teilnehmer*innen sahen die Gefahr, dass 24-stündige Bereitschaftsdienste der Psychotherapeut*innen die ohnehin schon geringe stationäre Psychotherapiedosis weiter verringern könnten. Auch müssten Bereitschaftsdienste angemessen vergütet werden. Die Bereitschaft, in Zukunft mehr Verantwortung, Aufgaben und Pflichten in den Kliniken zu übernehmen, sei aber grundsätzlich da. „Der Berufsstand kann sich künftig viel breiter in der stationären Versorgung verankern“, erklärte Tobias Michl, ehemaliger Mitarbeitervertreter und Betriebsrat im Krankenhaus. Die Psychotherapeut*innen hätten dafür die erforderlichen Kompetenzen, und der Mangel an ärztlichen Fachkräften böte gute Voraussetzungen, um zusätzliche Vergütungen und angemessene Arbeits- und Pausenregelungen durchzusetzen.